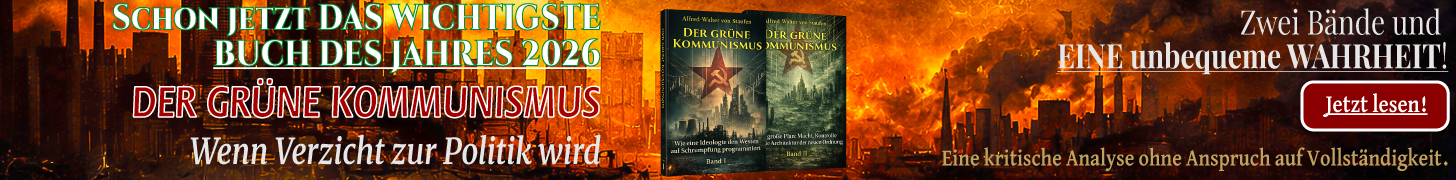Tanz der Schuldlosen – 15 Jahre nach Duisburg
Im Takt der Verantwortungslosigkeit – Eine Tragödie ohne Täter
Was vor 15 Jahren geschah: Es war ein Tag, der mit wummernden Bässen begann – und mit 21 Toten endete. Ein Tag, der eigentlich in die Geschichte der Glückseligkeit eingehen sollte, in die Kollektivtherapie eines Volkes, das sich selbst am liebsten tanzend vergaß. Am 24. Juli 2010 strömten über eine Million Menschen nach Duisburg, um an der Loveparade teilzunehmen – einer einst von Dr. Motte und Westbam gegründeten technoiden Utopie, die im Laufe der Jahre vom politischen Happening zur kommerzialisierten Massenbespaßung degeneriert war. Aus Liebe zur Musik wurde der „Totentanz zur Betonwand“.
Die Stadt Duisburg hatte – gegen alle Warnungen – das Ereignis genehmigt. Der Ort: ein ehemaliges Güterbahnhofsgelände, umzingelt von Zäunen, Mauern, Sackgassen. Es war keine Bühne für freie Körper in Bewegung, sondern ein Labyrinth ohne Notausgang. Die Teilnehmer wurden durch einen einzigen Tunnel geführt, in dem es schließlich zu einer tödlichen Massenpanik kam. Menschen wurden zerquetscht, erdrückt, zerbrochen. Andere sprangen in suizidaler Panik von Treppen und Mauern. Und während oben auf den Wägen weiter getanzt wurde – stampfend, ignorant, im Rausch der Rhythmen – starben unten Menschen. Lautlos, sinnlos, und vor allem: ohne dass es irgendjemanden rechtlich interessierte.
15 Jahre später bleiben viele Fragen. Warum gab es keine Schuldsprüche? Warum wurden die Verantwortlichen nicht zur Rechenschaft gezogen? Warum haben Stadt, Polizei, Veranstalter und Politik ein Schweigen gewählt, das lauter dröhnt als jeder Subwoofer auf der Hauptbühne? Und was bedeutet es für ein Land, wenn es keinen Täter gibt – aber so viele Tote?
In diesem Essay graben wir uns durch die juristischen Ruinen, das moralische Vakuum und den seelischen Schutt einer Republik, die gelernt hat, sich herauszuwinden. Willkommen im Deutschland der Ausflüchte – 15 Jahre nach Duisburg.
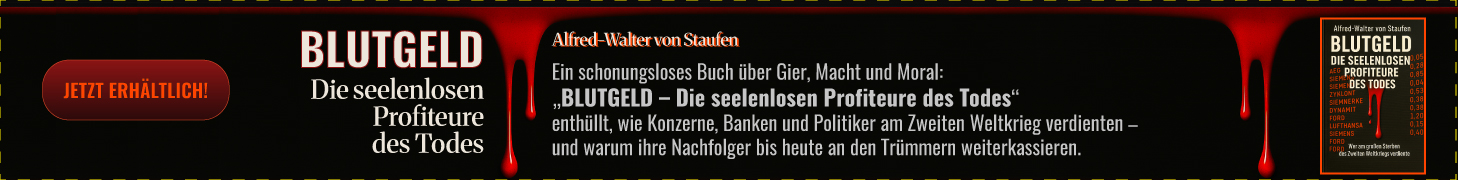
Eine Erinnerung von M.J. Lützeler und A.W. von Staufen
Der Tag, an dem der Rave starb – Minuten zwischen Euphorie und Ersticken
Die Loveparade war mehr als nur ein Festival. Sie war ein Versprechen. Ein Überbleibsel der 90er-Jahre-Utopie, dass elektronische Musik die Welt heilen könnte – mit Glitzer, Bass und der Kraft der kollektiven Ekstase. Doch in Duisburg 2010 wurde dieses Versprechen gebrochen, zerschmettert unter Stahlbeton und einer Veranstaltung, die zum Exempel wurde: Wie viele Menschen müssen eigentlich sterben, bevor jemand sagt: „Es war meine Schuld“?
Die Katastrophe entfaltete sich schleichend, geradezu kafkaesk. Am frühen Nachmittag begannen sich Menschenmassen vor dem einzigen Tunnelzugang zu stauen. Der Veranstaltungsort war zu klein, zu eng, zu absurd für die Dimension eines Megaevents. Es gab keine ausreichenden Ein- und Ausgänge, keine funktionierenden Fluchtwege, keine Pufferzonen. Stattdessen: Sackgassen, Zäune, und eine Stadt, die überfordert war – aber sich brüstete, mit diesem Event international zu glänzen.
Als gegen 16:30 Uhr die Panik ihren Höhepunkt erreichte, war es kein schneller Zusammenbruch, sondern ein minutenlanges Sterben im Stehen. Menschen wurden gegen Wände gedrückt, unter Körpern begraben, konnten weder vor noch zurück. Sie schrien, flehten, weinten – vergeblich. Die Polizei war machtlos oder überfordert oder beides. Sanitäter kamen nicht durch. Hilfe versickerte im Gedränge. Und während unten das Elend tobte, wurde oben weiter gefeiert. Der Bass wummerte. Die Tanzenden wussten nichts – oder sie wussten es, aber wollten es nicht wissen. Auch das ist Deutschland.
Die Loveparade starb an diesem Tag – und mit ihr 21 junge Menschen. Über 650 weitere wurden teils schwer verletzt, viele traumatisiert. Es war die schlimmste Massenpanik in der Geschichte der Bundesrepublik. Und doch schien sie erstaunlich schnell aus dem öffentlichen Bewusstsein zu verschwinden. Nicht, weil sie unwichtig war, sondern weil sie unangenehm war. Duisburg war kein tragischer Unfall. Duisburg war ein Ergebnis.
Ein Ergebnis von Profitgier, Selbstüberschätzung, politischer Eitelkeit und jener typisch deutschen Form der Zuständigkeitsvermeidung, bei der am Ende alle zuständig waren – und somit niemand. Jeder hatte irgendwie rechtzeitig gewarnt, aber niemand hatte etwas verhindert. Jeder wusste, dass das Gelände ungeeignet war, aber jeder unterschrieb. Jeder meinte, das Sicherheitskonzept sei problematisch, aber alle setzten ihre Namen darunter. Und dann? Dann wurde getanzt. Bis zum Tod.
Das Schweigen der Akten – Wie sich Verantwortung in Luft auflöste
Nach der Katastrophe kam die Erschütterung – kurz. Politiker äußerten Betroffenheit, Veranstalter versprachen Aufklärung, Medien sendeten Sondersendungen mit Drohnenaufnahmen des Tunnels, in dem Menschen zu Tode gedrückt worden waren. Es war ein kollektives Schuldbewusstsein auf Probezeit. Denn schnell folgte: das große Schweigen.
Das Ermittlungsverfahren wurde zu einem Justizkrimi der besonderen Art. Insgesamt 17 Personen wurden zunächst beschuldigt – darunter städtische Beamte, Mitarbeiter des Veranstalters Lopavent, Sicherheitsplaner. Doch schon früh wurde klar: Man würde alles tun, um niemanden verurteilen zu müssen.
Die juristische Aufarbeitung war geprägt von Gutachten, Gegengutachten, Fristen, Anfechtungen. 2014 wurde das Verfahren mangels Tatverdacht gegen sieben Beschuldigte eingestellt. Gegen zehn andere wurde 2017 – also ganze sieben Jahre nach dem Ereignis – der Prozess eröffnet. Doch auch dieser Prozess geriet zur Farce: Der Richter erkrankte, Corona verzögerte, Beweismittel wurden diskutiert wie theologische Schriftrollen. Und am Ende, im Mai 2020 – zehn Jahre nach dem Ereignis – wurde das Verfahren ohne Urteil eingestellt. Alle Angeklagten waren frei. Nicht schuldig. Nie gewesen. Wie durch ein Wunder, ein juristisches Placebo, das Verantwortung heilt.
Die Begründung: Es sei „nicht mit der notwendigen Sicherheit nachweisbar“, wer genau die entscheidenden Fehler begangen habe. Das bedeutet: Man wusste, dass Fehler begangen wurden – nur war es unmöglich, einen Namen dranzuschreiben. In Deutschland stirbt man nicht an Fehlern, sondern an Systemversagen – das klingt bürokratischer und lässt sich besser aushalten.
Kein Bürgermeister trat zurück. Kein Veranstalter spendete ein Vermögen. Kein Innenminister sagte: „Wir haben versagt.“ Stattdessen: Aktenordner, Paragraphen, Schlupflöcher, Formulare. Eine Republik im Verwaltungsmodus.
15 Jahre später erinnern sich viele an das Ereignis – aber kaum einer an die Namen der Toten. Das ist vielleicht das Schlimmste: Nicht das Versagen. Sondern das Verblassen. Als sei es ein bedauerlicher Unfall gewesen, wie ein Blitzeinschlag oder eine plötzliche Sturmflut. Dabei war es hausgemacht – im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Hinterbliebenen – Trauer trifft auf Gleichgültigkeit
Es gibt keinen Grabstein für Verantwortung. Und keinen Gerichtsakt, der tröstet. Was bleibt, ist Leere. Und Schmerz. Und die Stimmen derer, die nicht verstummten, obwohl das Land sie gerne überhört hätte: die Hinterbliebenen. Eltern, Geschwister, Freunde – Menschen, die nicht damit leben müssen, dass jemand starb, sondern dass niemand dafür geradesteht.
Was sagt man zu einer Mutter, deren Tochter an jenem 24. Juli unter Menschenleibern erstickte – während oben auf den Trucks das „Leben gefeiert“ wurde? „Tut uns leid“? Wäre ein Anfang gewesen. Doch Entschuldigungen sind rar in deutschen Amtsstuben. Es könnte ja juristisch relevant sein. Also redet man lieber über „tragische Einzelfälle“ und „strukturelle Probleme“. Wie man es eben tut, wenn man lieber nicht fühlt.
Viele der Hinterbliebenen fühlten sich im Stich gelassen – nicht nur von der Justiz, sondern vom ganzen Land. Keine würdige Gedenkveranstaltung in den ersten Jahren. Keine persönliche Ansprache der politischen Verantwortlichen. Kein Besuch vom damaligen Innenminister. Stattdessen: Schweigen. Amtsdeutsch. Eine Mauer des Desinteresses, höher als jeder Sicherheitszaun rund ums Veranstaltungsgelände.
Einige Angehörige gründeten Initiativen, hielten Mahnwachen ab, kämpften für Erinnerung, für Gerechtigkeit, für einen Ort des Gedenkens. 2012 wurde schließlich ein Mahnmal errichtet – „21 Bäume für 21 Leben“. Eine stille Geste. Schön. Poetisch. Doch leider: völlig folgenlos. Denn ein Mahnmal ersetzt keine Aufarbeitung. Und ein Wald ersetzt keinen Schuldspruch.
Die Interviews mit den Hinterbliebenen gleichen sich erschreckend. Ein Vater, der die Leiche seines Sohnes auf einem Handyvideo identifizierte. Eine Mutter, die jahrelang auf die Akteneinsicht wartete. Ein Bruder, der vom Prozess ausgeschlossen wurde, weil er formell nicht klageberechtigt war. Deutschland, das Land der Formulare – sogar beim Tod.
Und was macht das mit einem Land? Mit einer Gesellschaft, die die Trauer delegiert und das Versagen verjährt? Es macht sie kalt. Und kalkulierend. Und leer. Denn ein Land, das keine Fehler eingesteht, verliert nicht nur an Moral – es verliert an Menschlichkeit.
15 Jahre später sind die meisten der Verantwortlichen längst in Rente, umgezogen, in Vorruhestand oder einfach verschwunden aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit. Die Opfer aber sind geblieben – in den Herzen der Angehörigen. Und in einem Justizsystem, das lieber niemanden verurteilt, als den Falschen. Das mag juristisch sauber sein. Aber moralisch? Ein Armutszeugnis.
Das System Loveparade – Wie ein Kult zur Katastrophe wurde
Die Loveparade war nie nur eine Party. Sie war Mythos, Marke, Millionenspektakel. Sie war das technoide Woodstock für das wiedervereinigte Deutschland. Eine Demonstration für „Friede, Freude, Eierkuchen“ – anfangs noch mit politischem Anstrich, später vor allem mit Sponsorenlogo.
Was 1989 in Berlin begann, als schräge Idee eines DJs mit idealistischem Impuls, wurde binnen eines Jahrzehnts zu einem Moloch aus Brachialbass, Halbnacktheit und Marketing. Statt einer Demo für Liebe wurde sie zur Bühne der Selbstinszenierung: für Marken, für Städte, für Politiker. Und irgendwann ging es nicht mehr um die Parade – sondern nur noch darum, wer sie austragen durfte. Der Zuschlag wurde wie die Olympischen Spiele gehandelt. Duisburg war der letzte Austragungsort. Und: der schlechteste.
Warum? Weil das Gelände ungeeignet war. Weil die Stadt überfordert war. Weil die Veranstalter am Sicherheitskonzept sparten, wie man sonst nur an Bildung spart. Weil es keine politischen Nein-Sager mehr gab, sondern nur noch Ja-Abnicker. Und weil niemand wagte, zu sagen: „Das können wir nicht stemmen.“
Es war ein Tanz auf dem Vulkan – nur dass niemand tanzte, sondern stampfte. Die Loveparade 2010 war ein Paradebeispiel für kollektives Wegsehen. Für ein System, in dem alle alles wissen, aber keiner handelt. In dem Geld wichtiger ist als Gesundheit. Und Image über Sicherheit steht.
Veranstalter Lopavent wollte Profit. Die Stadt Duisburg wollte Glanz. Die Politik wollte gute PR. Und die Polizei? Wollte irgendwie durch den Tag kommen. Alle wollten irgendwas – nur niemand wollte die Verantwortung. Und so wurde aus einem Rave ein Requiem.
Die Kultur des Davonkommens – Warum niemand haftet, wenn alle versagen
In Deutschland stirbt man nicht durch Schuld – sondern durch Strukturen. Das ist beruhigend. Und tödlich.
Die Loveparade-Katastrophe hat nicht nur gezeigt, dass der Tod keine Gerechtigkeit kennt – sie hat auch offengelegt, wie wenig unser System mit kollektiver Verantwortung anfangen kann. Denn: In einem Land, in dem Zuständigkeiten wie heiße Kartoffeln weitergereicht werden, verdampft Verantwortung schneller als ein Nebelstrahler im Club.
Die juristische Frage, wer versagt hat, wurde zehn Jahre lang gestellt. Am Ende lautete die Antwort: viele. Und da viele versagt haben, war es juristisch nicht mehr greifbar, wer genau. Die Logik: Wenn alle ein bisschen schuld sind, ist keiner genug schuld, um verurteilt zu werden. Willkommen in der Exekutivarithmetik des Grauens.
Hinzu kommt: Das deutsche Strafrecht ist nicht gemacht für komplexe Fehlerketten. Es liebt den klaren Täter mit klarer Tat. Doch bei Großereignissen, bei denen Planer, Genehmiger, Ausführer und Kontrolleure sich gegenseitig aufeinander verlassen, zerfällt der Schuldbegriff. Und wird zum Nebel. Oder schlimmer: zur Farce.
Das Verfahren wurde aus formalen Gründen eingestellt – nicht, weil niemand Schuld hatte, sondern weil niemand individuell haftbar gemacht werden konnte. Und das ist der Unterschied zwischen Recht und Gerechtigkeit. Zwischen Paragraf und Ethik. Zwischen Aktenlage und Würde.
In anderen Ländern hätte es Rücktritte gegeben. In Frankreich hätte ein Minister Tränen in den Augen. In Südkorea wäre ein Bürgermeister wahrscheinlich zurückgetreten – oder hätte sich gar öffentlich entschuldigt. In Deutschland? Da wurden die Zuständigen befördert. Oder versetzt. Oder einfach unsichtbar.
Das ist die wahre Tragödie: Dass 21 Menschen starben – und niemand Konsequenzen spürte. Keine politischen. Keine juristischen. Keine moralischen. Der einzige spürbare Schmerz blieb bei den Angehörigen. Und im Beton des Tunnels. Der steht noch heute. Mahnend. Nutzlos.
Ein Land ohne Schuldbekenntnis – Das Schweigen als Staatsdoktrin
Es gibt Länder, in denen Politiker für einen schlechten Satz zurücktreten. Und dann gibt es Deutschland. Hier kann man eine Katastrophe verwalten wie ein Bauantragsformular. Mit Stempel, Schriftsatz und juristischer Sterilität. Ohne Tränen, ohne Zorn, ohne echte Worte. Nur Formeln: „Ein tragisches Unglück.“ – „Eine Verkettung unglücklicher Umstände.“ – „Ein Fehler im System.“
Willkommen im Schweigekabinett der Verantwortungsvermeidung.
Dass in der Bundesrepublik auch 15 Jahre später niemand – wirklich niemand – aus der politischen, verwaltungstechnischen oder veranstalterischen Riege öffentlich die Schuld auf sich nahm, ist kein Betriebsunfall. Es ist Staatskultur. Schuld ist in Deutschland nicht das Eingeständnis einer moralischen Verfehlung. Schuld ist ein justizielles Risiko. Eine PR-Gefahr. Ein Rücktrittsgrund – den man mit aller Gewalt verhindern muss.
Die Stadt Duisburg hat sich nach der Katastrophe vor allem um eines bemüht: Rechtsschutzversicherungen. Der damalige Oberbürgermeister Adolf Sauerland, CDU, trat nicht etwa aus moralischer Einsicht zurück, sondern wurde erst neun Monate später – nach anhaltendem öffentlichem Druck – abgewählt. Bis dahin saß er aus. Wörtlich. Mit Beamtenmiene und leeren Blicken. Kein Kniefall. Kein Trostwort an die Angehörigen. Und wenn doch, dann las es sich wie ein auswendig gelerntes Schulreferat zur Verkehrssicherheit.
Auch die Veranstalterfirma Lopavent bemühte sich rasch darum, sich unsichtbar zu machen. Ein Unternehmen in Auflösung. Der Geschäftsführer: untergetaucht, juristisch weich abgefedert, von Haftung befreit. Denn wenn man das Risiko gut genug verteilt hat, ist niemand mehr zuständig. Und niemand mehr sichtbar.
Diese Schweigekultur zieht sich wie eine Leitung durch den Beton der deutschen Verwaltungsetagen. Sie nährt sich aus einem Mix aus Angst, Opportunismus und juristisch kalkuliertem Desinteresse. Wer spricht, könnte angreifbar sein. Wer schweigt, hat die Chance, durchzukommen. Und so wurde der größte zivile Veranstaltungstod seit der Loveparade zu einem Fall ohne Worte. Ohne Schuld. Ohne Folgen. Nur mit Folgen für die Falschen: die Opfer.
Deutschland ist gut darin, Katastrophen zu archivieren. Aber schlecht darin, sie aufzuarbeiten. Der Tunnel, in dem die Menschen starben, wurde lange nicht umbenannt, nicht gesperrt, nicht symbolisch gewürdigt. Er blieb einfach da – wie ein Mahnmal der Gleichgültigkeit. Die Gerichte sagten: „Es war keiner direkt verantwortlich.“ Der Staat sagte: „Es war keiner politisch verantwortlich.“ Und die Geschichte sagt heute: Es war… niemand?
Nein. Es war jeder. Aber alle waren so gut verteilt, dass niemand allein zu fassen war. Und deshalb bleibt dieses Land ein Land der Nebensätze, wenn es um Verantwortung geht. Niemand war schuld. Aber alle waren beteiligt. Und so stirbt nicht nur das Vertrauen – sondern auch die Wahrheit.
Die Moral der Maschinen – Wenn Menschen zu Massen werden
Was geschah in Duisburg, wenn man es seziert, abstrahiert, auf die Seziertische der Soziologie legt? Ein Massenphänomen. Eine statistische Entgleisung. Ein logistisches Fehlversagen im Hochbetrieb. Doch hinter dieser nüchternen Sprache verbirgt sich eine grausame Wahrheit: Menschen wurden wie Zählgrößen behandelt. Wie Einheiten in einer Masse, die man zu- und abführen kann. Bewegung im Schwarm. Ein Fluss aus Fleisch.
Der Mensch als Masse verliert sein Gesicht – und damit auch seinen Anspruch auf Schutz. Das ist die perfide Grundvoraussetzung moderner Großveranstaltungen: Der Einzelne zählt nicht. Der Körper ist ein Punkt im Crowd-Management. Eine Variable in der Formel. Und wenn das System versagt? Dann ist eben die Formel schuld. Nicht der Mathematiker. Nicht der Veranstalter. Sondern die Physik der Panik.
In Duisburg redete man später viel über „Crowd Dynamics“, über „Bottleneck-Effekte“, über das „Gegenstromprinzip“. Es wurden Diagramme gezeigt, mit Pfeilen, mit Flächen, mit roten Punkten, die symbolisierten, wo der Mensch starb – aber nicht wer.
Die Entmenschlichung begann lange vor der Katastrophe. Sie begann mit der Planung. Mit Excel-Tabellen. Mit Einlasskontrollen. Mit dem Irrglauben, dass man eine Million Menschen auf ein ehemaliges Güterbahnhofsgelände pressen kann, als sei das eine logistische Lösung – nicht ein moralisches Versagen.
Niemand fragte: Was passiert, wenn jemand stürzt? Wenn jemand stolpert? Wenn jemand nicht mehr atmen kann? Man vertraute der Technik. Der Polizei. Den Zäunen. Der Statik. Der Gier.
Und dabei vergaß man das wichtigste Element: den Menschen.
Die Loveparade war ein Massenerlebnis. Und gerade deshalb wäre es so wichtig gewesen, den Einzelnen zu schützen. Aber der Einzelne störte. Er war ein Risiko. Eine Unbekannte. Eine Variable, die sich nicht kontrollieren lässt. Und so wurde auch seine Würde zur Rechengröße.
Die Moral der Maschinen aber kennt keinen Schmerz. Sie kennt keinen Rücktritt. Sie kennt keine Reue. Sie kennt nur Zustände. Und so wurde die Katastrophe zur technischen Störung erklärt. Zur strukturellen Kettenreaktion. Zur Systemüberlastung. Es war alles erklärbar – und niemand fühlte mehr.
Vielleicht liegt darin das wahre Drama: Dass wir uns an solche Erklärungen gewöhnt haben. Dass wir gelernt haben, Katastrophen in Infografiken zu begreifen – und nicht in Gesichtern. Dass der Tod 21 junger Menschen zu einem Kapitel in einem Evaluierungsbericht wurde. 27 Seiten. Mit Schaubild. Und Fußnote.
Ein Fußtritt für die Menschlichkeit.
Und weil es so gut passt, ließ man auch die Konsequenzen von Maschinen erledigen: Versicherungen zahlten. Juristen argumentierten. Politiker verwalteten. Und der Mensch? Starb. In der Statistik. Im Gedränge. In der Bedeutungslosigkeit.
Ein Mahnmal, das keiner sehen will – Erinnerung zwischen Beton und Bass
Es gibt Orte, da schreit der Beton. Er schreit nicht laut. Aber dumpf. Er trägt den Klang von eingeklemmten Rippen, von gebrochenem Atem, von letzter Hoffnung. Der Tunnel in Duisburg, Schauplatz der Loveparade-Katastrophe, ist so ein Ort.
Und doch geht man achtlos daran vorbei. Als sei dort nie etwas geschehen. Als sei das alles ein Schatten, der schon zu lange liegt, um noch gesehen zu werden.
2012 wurde ein Mahnmal errichtet: „21 Bäume für 21 Leben“. Sie wachsen still am Rande. Fernab des Tunnels. Fernab des Geschehens. Vielleicht, weil Erinnerung in Deutschland gern an den Rand geschoben wird. Dorthin, wo sie nicht stört. Wo sie nicht mahnt. Wo sie nicht jeden Tag daran erinnert, dass ein Staatsversagen 21 Namen hat.
Denn das ist das eigentliche Mahnmal, das fehlt: ein Gedenken im Zentrum der Katastrophe.
Ein öffentliches, unübersehbares, ein mit Nachdruck errichtetes Zeichen. Kein Bronzeblatt in einem Park. Sondern eine Wahrheit aus Stein:
„Hier starben 21 Menschen, weil keiner Verantwortung übernahm.“
Doch das wäre zu ehrlich. Zu konkret. Zu unbequem.
Stattdessen läuft die Stadt Duisburg heute lieber PR-Kampagnen für neues Vertrauen. Die Bürger sollen vergessen. Die Besucher sollen verdrängen. Die Investoren sollen kommen. Die Stadt sei im Wandel, heißt es.
Doch wie wandelt sich ein Ort, der seine Toten verschweigt? Wie heilt eine Stadt, die ihre Wunden betoniert?
Der Tunnel steht noch. Er trägt die gleichen Graffitis wie damals. Die gleichen Risse. Die gleiche Geschichte. Man hat ihn nicht symbolisch gesperrt. Nicht öffentlich umbenannt. Nicht zu einem Mahnmal des kollektiven Versagens gemacht. Vielleicht, weil man Angst hat, was passiert, wenn man anfängt, wirklich zu erinnern.
Denn Erinnern heißt: anerkennen.
Anerkennen, dass diese 21 Menschen nicht an einem Unfall starben. Sondern an einem Systemversagen. An einer Kombination aus politischer Gier, verwaltungstechnischer Ignoranz und der kalten Mechanik einer Gesellschaft, die gelernt hat, nicht hinzusehen.
Nicht fühlen.
Nicht bekennen.
Die Angehörigen erinnern. Jahr für Jahr. Auf eigene Kosten. Mit stillen Kerzen, mit Namen auf Bannern, mit klammen Händen. Sie stehen da, wo andere nicht mehr hinsehen wollen. Dort, wo es wehtut.
Und das allein – ist das letzte Gewissen dieser Republik.
Der letzte Takt – Wenn Schweigen lauter ist als Bass
15 Jahre nach der Loveparade-Katastrophe bleibt die Bilanz nüchtern:
- 21 Tote.
- 652 Verletzte.
- 0 Verurteilungen.
- 0 Entschuldigungen.
- 0 politische Konsequenzen.
Das ist keine Statistik. Das ist ein Symbol.
Ein Symbol für ein Land, das mit jedem Jahr besser darin wird, Katastrophen zu verarbeiten – und schlechter darin, Schuld zu benennen. Es war ein Staatsversagen, wie es im Lehrbuch steht. Nur dass das Lehrbuch nie geschrieben wurde. Stattdessen: Protokolle. Stellungnahmen. Erinnerungen, die im Aktenstaub verwittern.
Und mittendrin: eine Gesellschaft, die sich immer wieder die gleiche Frage stellt – und sie doch nicht beantwortet:
Wie konnte das geschehen?
Vielleicht so: Weil es niemand verhindern wollte. Weil niemand widersprechen wollte. Weil alle im Gleichschritt marschierten – zum Beat der Verantwortungslosigkeit.
Was bleibt von Duisburg 2010?
Ein Tunnel, in dem die Menschlichkeit vergraben wurde.
Eine Liste von Namen, die in keiner Schulstunde gelehrt werden.
Und Angehörige, die sich Jahr für Jahr ihre Gedenkminute erkämpfen müssen.
Denn das System gibt ihnen keine.
Vielleicht ist das das Bitterste:
Dass dieses Land keinen Umgang mit Schuld kennt, der über Geldbeträge und juristische Spitzfindigkeiten hinausgeht. Dass ein Kniefall immer noch als Schwäche gilt. Dass ein „Es tut mir leid“ als PR-Schaden verwaltet wird. Und dass der Tod – wenn er verwaltet wurde – keine Stimme mehr hat.
Doch die Toten sind nicht still.
Sie sprechen aus jedem Foto, jedem Gedenkstein, jedem stillen Protest der Familien.
Sie mahnen: dass Erinnern nicht reicht, wenn es folgenlos bleibt.
Dass keine Gesellschaft gesund sein kann, die ihre Toten ignoriert.
Und dass wahre Gerechtigkeit nur dann beginnt, wenn jemand den Mut hat, Schuld anzunehmen.
Duisburg ist nicht vorbei.
Es ist nur vertagt.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zur nächsten Menschenmasse, die sich durch Zäune drängt.
Bis zur nächsten Planungsakte, in der ein Name fehlt.
Bis zum nächsten Tunnel, in dem wieder jemand schreit – und niemand hinhört.
„Der Takt der Schuld“
Ein Rave war’s einst, voll Glanz und Glut,
mit Beats im Bauch und Bass im Blut.
Man tanzte wild, man tat es gern –
doch mittendrin starb ein moderner Stern.
Kein Krieg, kein Mord, kein Blitz vom Zorn,
nur Gitter, Gier und Einlass-Torn.
Der Tod kam still, durch Massenlast –
ein Mensch, der fällt, wird hier verpasst.
Es sprach kein Chef, kein Planer, kein Rat,
die Schuld war plötzlich – nicht mehr tatfähig parat.
Die Justiz nickte leise und stützte den Satz:
„Wenn viele es waren, war’s niemand, mein Schatz.“
Die Eltern weinten, das Land sah fern,
die Akte lag still, man log nicht mal gern.
Denn wenn Verantwortung auf viele fällt –
wird sie wie Staub vom Winde verweht.
Und so steht der Tunnel, als Mahnmal der Pflicht,
mit Graffiti der Feigheit und ohne Gesicht.
Kein Richter, kein Pfarrer, kein Bürgermeister,
nur leere Formeln, Bürokratie-Geister.
Drum merkt euch, ihr Planer von morgen und heut:
Der Tod kommt auch dann, wenn keiner ihn scheut.
Nicht jeder Skandal hat ein klar benanntes Ziel –
Doch die Wahrheit – sie stirbt oft sehr still.
Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben!
Diese Tragödie steht stellvertretend für ein Land, das totgetrampelte und zerquetsche Menschenopfer nur noch Platz in Statistiken findet, ohne Mitleid, ohne echte Reue und ohne Konsequenzen. Der kleine Mensch zählt schon lange nicht mehr, ist nur noch eine Zahl im großen Sudoku der Geschichte. Das ist leider traurig, aber wahr!!!
Bitte passen Sie auf sich auf und vor allem bleiben Sie gesund, denn das höchste Gut das wir pflegen müssen!!!
Herzlichst
Ihre M.J. Lützeler von Roden und A.W. von Staufen
Abbildungen:
- Alfred-Walter von Staufen
Quellen:
- Landgericht Duisburg (2020): Einstellung des Verfahrens zur Loveparade-Katastrophe – PM vom 04.05.2020.
- WDR Doku: „Die Akte Loveparade“ (2020), Recherchebeitrag zur juristischen Aufarbeitung.
- Süddeutsche Zeitung (24.07.2020): „Zehn Jahre nach der Katastrophe – Keine Schuld, keine Gerechtigkeit“.
- Der Spiegel (24.07.2020): Rückblick: „Duisburg 2010 – Eine Stadt im Ausnahmezustand“.
- de (24.07.2023): „13 Jahre danach – Gedenken an die Opfer der Loveparade“.
- Correctiv (2015–2020): Investigativ-Recherche zur Planung, Genehmigung und Risikokette.
- Loveparade Gedenkseite (www.loveparadegedenken.de): Opferbiografien, Zeitstrahl, Stimmen der Angehörigen.
- Frankfurter Rundschau (2020): „Verantwortung in Beton gegossen – Der Tunnel als Mahnmal“.
- ARD-Podcast „Der Fall Loveparade“ (2020): Interviews mit Hinterbliebenen und Juristen