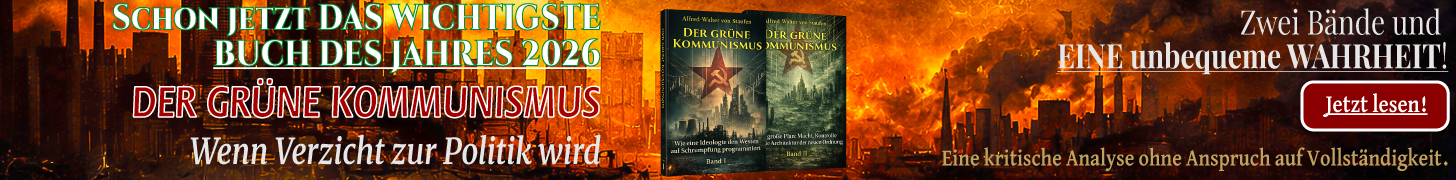Freibad-Warnkampagne in der Kritik: Frau begrapscht schwarzen Jungen auf Plakat – Stadt verteidigt Aktion
Die Sommersonne brennt, die Freibäder sind voll, und für viele Kinder ist der Sprung ins kühle Wasser der Höhepunkt der Ferien. Doch mitten in dieser scheinbar unbeschwerten Saison sorgt ein Vorfall in einem Freibad im nordrhein-westfälischen Büren für hitzige Diskussionen. Eine Kampagne, die eigentlich dem Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt dienen soll, gerät unter massiven Beschuss. Der Grund: Auf einem großformatigen Plakat wird eine weiße Frau gezeigt, die einem schwarzen Jungen mit sichtbarer Behinderung ans Gesäß fasst. Diese Darstellung stößt nicht nur bei Besucherinnen und Besuchern des Freibads auf Irritation, sondern entfacht auch bundesweit eine Debatte über die Art und Weise, wie Prävention, Täterbilder und gesellschaftliche Realitäten miteinander vermittelt werden dürfen und sollen.
Hintergrund der Aktion ist eine Präventionskampagne, die Kinder mithilfe eines einprägsamen Codeworts ermutigen soll, bei Übergriffen schnell Hilfe zu holen. „Tiki“ heißt das freundliche Maskottchen, eine Schildkröte, die Kindern vermitteln soll: Wenn dir jemand zu nahe kommt, darfst du „Tiki“ rufen und bekommst Unterstützung. Ein durchaus gut gemeinter Ansatz, wie auch Kinderschutzorganisationen betonen. Doch das Motiv, das auf dem Plakat zu sehen ist, hat eine Welle von Kritik ausgelöst, die bis in die sozialen Netzwerke und in politische Gremien reicht.
Viele Menschen empfinden das Bild als realitätsfern, da es eine weiße, weibliche Täterin zeigt, die ein schwarzes Kind begrapscht. Kritiker werfen den Verantwortlichen vor, damit die tatsächlichen Problemlagen zu verschleiern. Tatsächlich sprechen Polizeistatistiken in deutschen Freibädern seit Jahren von Tätern, die häufiger männlich und oft mit Migrationshintergrund sind. Die Darstellung auf dem Plakat hingegen zeigt das Gegenteil und wirkt dadurch auf viele wie eine bewusste Verzerrung, die gesellschaftliche Vorwürfe von Rassismus vermeiden soll.
Die Stadt Büren, die hinter der Aktion steht, verteidigt ihr Konzept. Man wolle keine Gruppen stigmatisieren, sondern grundsätzlich alle Formen sexualisierter Gewalt thematisieren und alle potenziellen Täterprofile sichtbar machen. Trotzdem zeigte sich die Stadtverwaltung offen für Kritik und versprach, einzelne Gestaltungselemente der Kampagne zu überprüfen. Auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow erklärte, dass der Schutz von Kindern und Jugendlichen oberste Priorität habe, und räumte ein, dass die öffentliche Diskussion wichtige Anstöße gebe.
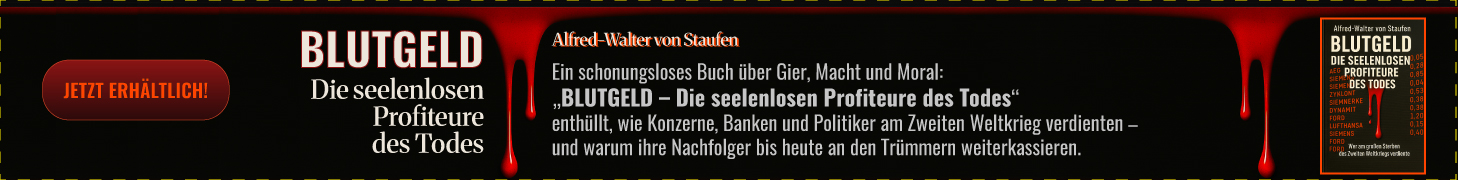
Doch die Debatte reicht inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus. Bundespolitiker, Polizeigewerkschaften und Sozialarbeiter melden sich zu Wort, kritisieren oder verteidigen die Kampagne und stellen grundsätzliche Fragen: Wie zeigt man Missbrauchsgefahr, ohne Vorurteile zu schüren? Wie kann Prävention gelingen, ohne in rassistische oder diskriminierende Stereotype zu verfallen – und ohne die Realität auszublenden?
Der Fall aus Büren wirft genau diese Fragen in grellem Licht auf. Er zeigt, wie schwierig es sein kann, gesellschaftliche Sensibilität mit wirksamer Aufklärung zu verbinden. Und er macht deutlich, dass der Kampf gegen sexualisierte Gewalt nicht nur Mut und Aufklärung verlangt, sondern auch ein tiefes Bewusstsein für die gesellschaftliche Wahrnehmung – selbst wenn diese manchmal schmerzhaft widersprüchlich ist.
Ein Kommentar von Alfred-Walter von Staufen
Die umstrittene Kampagne: Gute Absicht, schlechte Umsetzung?
Die Kampagne „Sommer – Sonne – Sicherheit“ wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um ein sensibles, aber enorm wichtiges Thema kindgerecht zu vermitteln: sexuelle Übergriffe im Freibad. Gerade in den heißen Sommermonaten, wenn Schwimmbäder zum Treffpunkt für hunderte Kinder und Jugendliche werden, ist das Risiko von Übergriffen oder Grenzverletzungen nicht zu unterschätzen. Deshalb wollten die Verantwortlichen der Stadt Büren gemeinsam mit einem Präventionsteam ein niederschwelliges Angebot schaffen. Das Konzept sah vor, über kindgerechte Figuren wie die Schildkröte „Tiki“ und leicht verständliche Botschaften Aufmerksamkeit zu schaffen, ohne dabei Angst zu machen.
Das Grundprinzip: Kinder sollen in einer unangenehmen Situation nicht hilflos bleiben, sondern ein Codewort nutzen können, um Erwachsene im Bad gezielt um Hilfe zu bitten. Dieses Codewort – „Tiki“ – wurde auf Plakaten, Flyern und an Schwimmbeckenwänden großflächig bekannt gemacht. Das Ziel war, dass sowohl Kinder als auch das Personal jederzeit wissen: Wer „Tiki“ ruft, braucht sofort Unterstützung. Eine pädagogisch sinnvolle Idee, die nach Ansicht vieler Präventionsexperten durchaus Potenzial hat.
Doch das Motiv, das die Kampagne symbolisch nach außen trägt, hat offensichtlich den gegenteiligen Effekt ausgelöst. Ein weißer, weiblicher Tätercharakter, der einen schwarzen Jungen mit Behinderung begrapscht, wurde von vielen Menschen als provokant, realitätsfern oder gar ideologisch motiviert empfunden. Im Internet brach eine hitzige Debatte los, bei der sich mehrere Gruppen zu Wort meldeten: Eltern, die das Motiv als „verstörend“ bezeichneten, Schwimmbadbesucher, die sich fragten, wie eine solche Darstellung entstehen konnte, und Polizeivertreter, die das Plakat inhaltlich für völlig unzutreffend hielten.
Insbesondere die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren laut Polizeiberichten und Medienberichten eher junge Männer mit Migrationshintergrund in Freibädern durch sexuelle Übergriffe auffällig wurden, sorgt für scharfe Kritik an der Kampagne. Viele Menschen fühlten sich durch die Darstellung auf dem Plakat regelrecht getäuscht und fragten, warum Täterbilder bewusst umgedreht würden. In sozialen Netzwerken tauchten unzählige Kommentare auf, die dem Motiv unterstellten, es solle politisch korrekt wirken und dabei die Realität verschleiern.
Zwischen Rassismusvorwurf und Realität
Genau hier entzündet sich ein schwieriges Spannungsfeld: Einerseits soll eine Präventionskampagne keinesfalls rassistische Klischees bedienen oder Menschen mit Migrationshintergrund pauschal unter Verdacht stellen. Andererseits entsteht bei vielen der Eindruck, dass die Verantwortlichen aus Angst vor solchen Vorwürfen das Täterprofil verzerrt hätten – auf Kosten einer authentischen Darstellung.
Der stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, sprach in einem vielbeachteten Beitrag von einem „erschreckend weltfremden Bild“. Er betonte, dass man zwar jede Form sexualisierter Gewalt thematisieren müsse, dass jedoch die Kampagne „kaum etwas mit der Wirklichkeit“ zu tun habe. Er verwies darauf, dass sich die meisten Übergriffe in Freibädern in den vergangenen Jahren nicht durch ältere Frauen, sondern durch junge Männer ereignet hätten – teils in Gruppen, teils mit massiver Einschüchterung.
Auch andere Stimmen äußerten ähnliche Kritik. In Leserkommentaren, Talkshows und Diskussionen im Netz wurde wiederholt die Frage gestellt, ob Kampagnen wie die in Büren der Realität noch gerecht würden oder ob sie gesellschaftliche Wahrheiten zugunsten einer übertriebenen political correctness weichzeichneten.
Die Stadt Büren selbst verteidigte sich nach Kräften. Bürgermeister Burkhard Schwuchow erklärte in einer schriftlichen Mitteilung, es sei nie das Ziel gewesen, Tätergruppen zu verschleiern oder Schuld umzudeuten. Vielmehr wolle man Kindern grundsätzlich klarmachen, dass Grenzverletzungen von jeder Person ausgehen können – unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. Dennoch zeigte sich die Stadt einsichtig und kündigte an, einzelne Motive noch einmal kritisch zu prüfen.
Ein Blick in die Polizeistatistik
Ein Blick auf belastbare Zahlen hilft, die Debatte einzuordnen. Laut Polizeistatistiken der vergangenen fünf Jahre kam es in deutschen Freibädern immer wieder zu Vorfällen sexueller Belästigung, die überwiegend von männlichen Tätern ausgegangen sind. Insbesondere junge Männer mit Migrationshintergrund, die zum Teil selbst noch Jugendliche waren, gerieten dabei in den Fokus. Polizeibeamte sprechen hier häufig von „Gruppendynamiken“, die in Freibädern entstehen und bei denen männliche Jugendliche Mädchen oder auch jüngere Kinder bedrängen.
Bekannt wurde etwa ein Vorfall im Juni 2025 im hessischen Gelnhausen, wo mehrere syrische Männer acht Mädchen im Alter zwischen 11 und 17 Jahren sexuell belästigt haben sollen. Solche Meldungen haben in den letzten Jahren in vielen Kommunen zu mehr Sicherheitspersonal, Hausverboten und zusätzlichen Präventionsmaßnahmen geführt.
Die Kampagne in Büren steht deshalb im Verdacht, genau diese Entwicklungen zu verschweigen oder zu verharmlosen. Kritiker argumentieren, dass ein realitätsnahes Motiv auch jungen Menschen deutlich machen müsste, wo statistisch die größten Gefahren liegen.
Die Sicht von Sozialarbeitern und Präventionsexperten
Sozialarbeiter hingegen warnen davor, Täterprofile zu stereotypisieren. Sie argumentieren, dass sexuelle Gewalt tatsächlich von allen Gruppen ausgehen kann – auch von Frauen. Laut einer Studie des Bundesfamilienministeriums sind rund fünf bis zehn Prozent aller Missbrauchsfälle im familiären oder sozialen Umfeld weiblichen Tätern zuzuschreiben. Zwar spiele dies in Freibädern kaum eine Rolle, aber der Präventionsgedanke dürfe nicht darauf hinauslaufen, dass bestimmte Gruppen per se ausgeschlossen würden.
„Wir wollen, dass Kinder lernen: Jede unerwünschte Berührung ist falsch, egal von wem sie kommt“, sagt etwa Stefanie Kunert, Präventionstrainerin in Nordrhein-Westfalen. „Natürlich können wir in der Realität Tätergruppen beschreiben, aber wir dürfen Kinder nicht in die Falle laufen lassen, dass sie bei Frauen oder Bekannten nicht mehr aufmerksam sind.“
Hier entsteht also ein Zielkonflikt: Einerseits sollen Präventionskampagnen realistisch sein, andererseits aber auch grundsätzlich für jedes potenzielle Risiko sensibilisieren. Dieser Konflikt lässt sich nicht einfach auflösen und sorgt dafür, dass Kampagnen immer wieder zwischen den Polen „realitätsnah“ und „neutral“ schwanken.
Zwischen Verantwortung und Empörung
Die Verantwortlichen in Büren haben angekündigt, sich den Vorwürfen zu stellen und mit Fachleuten, Eltern und Polizeivertretern noch einmal über die Gestaltung der Kampagne zu sprechen. Gleichzeitig wird aber auch betont, dass das Ziel – nämlich Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen – weiterhin kompromisslos verfolgt werden soll.
Bürgermeister Schwuchow formulierte es so: „Jede Form sexualisierter Gewalt ist inakzeptabel, egal, von wem sie ausgeht. Wenn wir aber Menschen mit der Kampagne irritiert haben, nehmen wir das ernst und schauen genau hin.“
Damit ist klar: Die Plakataktion in Büren könnte am Ende sogar einen positiven Nebeneffekt haben, indem sie eine längst überfällige gesellschaftliche Diskussion anstößt. Diese Diskussion dreht sich nicht nur um Motive und Plakate, sondern im Kern um die Frage, wie Prävention im 21. Jahrhundert aussehen soll.
Wie viele sexuelle Übergriffe in Schwimmbädern gibt es in Deutschland?
Es gibt keine bundeseinheitliche Sonderstatistik, die nur Übergriffe in Schwimmbädern ausweist. Die Fälle werden unter den allgemeinen Straftatbeständen „sexuelle Belästigung“, „sexueller Missbrauch“ oder „Vergewaltigung“ geführt und nicht getrennt nach Tatort Schwimmbad veröffentlicht. Dennoch existieren belastbare Anhaltspunkte aus Polizeimeldungen und kommunalen Statistiken:
- Der Deutsche Städtetag (2023) berichtet, dass in Bädern „bundesweit jedes Jahr mehrere Dutzend bis über hundert Fälle von sexuellen Übergriffen gemeldet“ werden.
- In einer Umfrage des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister (2022) gaben rund 15 % der Bäderbetriebe an, in einer Saison mindestens einen sexuellen Übergriff registriert zu haben.
- In Berlin wurden zwischen 2019 und 2023 laut Polizei etwa 15–30 Anzeigen pro Jahr aus Freibädern im Zusammenhang mit sexualisierten Übergriffen erstattet (Quelle: Berliner Polizei-Statistik).
- In NRW wurden 2022 nach Medienberichten rund 60 sexuelle Belästigungen in Schwimmbädern polizeilich registriert (WAZ, 07/2022).
- Die Dunkelziffer wird von Fachleuten, z. B. vom Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, auf ein Vielfaches geschätzt, da gerade Kinder und Jugendliche oft keine Anzeige erstatten (Quelle: Deutscher Kinderschutzbund, 2023).
Zusammengefasst bedeutet das:
- pro Saison sind etwa 100–150 angezeigte Fälle bundesweit realistisch, dazu kommt eine unbekannte, wahrscheinlich deutlich höhere Dunkelziffer.
Tätergruppen: Wer wird in Freibädern auffällig?
Hier gibt es Daten aus polizeilichen Berichten und Medien, vor allem in Großstädten:
- Männliche Täter sind bei weitem die Hauptverdächtigen — Schätzungen sprechen von 95 % männlicher Tatverdächtiger (Quelle: BKA-Lagebild Sexuelle Gewalt, 2023).
- Junge Männer mit Migrationshintergrund treten in den Polizeiberichten überproportional häufig auf:
- Laut Berliner Polizei (2023) hatten in über 60 % der angezeigten Fälle in Freibädern die Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund.
- In Köln wurde 2022 in 48 % der Fälle von Belästigungen im Schwimmbad ein Verdächtiger mit ausländischer Staatsbürgerschaft ermittelt (Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger, 2022).
- In Hamburg berichten Bäderbetriebe seit 2018 von teils organisierten Gruppen junger Männer, meist aus arabischen oder nordafrikanischen Herkunftsländern (Hamburger Abendblatt, 2021).
- Frauen als Täterinnen sind extrem selten. Das Bundesfamilienministerium schätzt ihren Anteil im öffentlichen Raum auf unter 5 % (BMFSFJ-Bericht 2022), wobei konkrete Zahlen für Schwimmbäder nicht gesondert erhoben werden.
Quellen und Nachweise
- Bundeskriminalamt, Lagebild „Sexuelle Gewalt gegen Kinder“ 2023
- Deutscher Kinderschutzbund, Dunkelfeld-Schätzungen (2023)
- Berliner Polizei, Pressemitteilungen 2019–2023 zu Freibad-Vorfällen
- WAZ („60 sexuelle Belästigungen in NRW-Schwimmbädern gemeldet“, 07/2022)
- Kölner Stadt-Anzeiger („Sexuelle Übergriffe in Kölner Bädern“, 2022)
- Deutscher Städtetag, Bäderumfrage 2023
- Hamburger Abendblatt („Gruppen junger Männer bedrängen Mädchen im Freibad“, 2021)
Wie häufig passieren sexuelle Übergriffe in Freibädern wirklich?
Freibäder gelten für viele als Ort der Freiheit und der sommerlichen Leichtigkeit. Kinder planschen, Jugendliche spielen im Wasser, Erwachsene genießen die Sonne. Doch hinter dieser sorglosen Kulisse kommt es immer wieder zu Grenzüberschreitungen, die gravierende Folgen für die Betroffenen haben können. Sexuelle Übergriffe sind kein Einzelfall, sondern tauchen in Freibädern regelmäßig auf – wenn auch deutlich seltener, als manche Schlagzeilen vermuten lassen.
Eine umfassende bundesweite Statistik speziell für Freibäder existiert bislang nicht. Anzeigen wegen sexueller Übergriffe werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik unter allgemeinen Rubriken wie „sexuelle Belästigung“ oder „sexueller Missbrauch“ geführt und nicht nach Tatorten unterschieden. Trotzdem gibt es belastbare Anhaltspunkte, die ein ungefähres Bild zeichnen.
Nach Angaben des Deutschen Städtetags melden Bäderbetriebe jedes Jahr mehrere Dutzend bis über 100 Vorfälle von sexuellen Belästigungen oder Übergriffen in deutschen Freibädern. Eine Umfrage des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister von 2022 ergab, dass etwa 15 % der befragten Schwimmbäder in einer Saison mindestens einen Fall verzeichnen. In Großstädten wie Berlin, Köln oder Hamburg sind die Zahlen teils höher, da diese Bäder oft sehr hohe Besucherzahlen und eine dichte soziale Durchmischung aufweisen.
Die Berliner Polizei zum Beispiel registrierte in den Jahren 2019 bis 2023 durchschnittlich 15 bis 30 Anzeigen jährlich, die explizit aus Freibädern stammten. Ähnliche Größenordnungen meldete auch das Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo laut Medienberichten im Jahr 2022 rund 60 Übergriffe zur Anzeige kamen. Bundesweit dürfte man realistisch von etwa 100 bis 150 angezeigten Fällen pro Saison ausgehen, wobei Experten wie der Deutsche Kinderschutzbund die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher einschätzen. Viele Kinder und Jugendliche trauen sich nicht, eine Anzeige zu erstatten, weil sie sich schämen oder Angst vor den Reaktionen der Familie haben.
Wenn man die Tätergruppen genauer betrachtet, zeichnen sich recht klare Muster ab. Der überwiegende Anteil der Täter ist männlich – laut Bundeskriminalamt betrifft das rund 95 % der Tatverdächtigen bei sexualisierten Übergriffen allgemein. Für den speziellen Tatort Schwimmbad bestätigen viele Polizeistellen dieses Verhältnis. Auffällig ist außerdem, dass in Ballungsräumen überproportional häufig junge Männer mit Migrationshintergrund unter den Tatverdächtigen sind. In Berlin hatten nach Angaben der Polizei im Jahr 2023 rund 60 % der in Freibädern ermittelten Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund. In Köln waren es 48 % im Jahr 2022.
Experten erklären diesen Befund damit, dass Gruppen junger Männer mit Flucht- oder Migrationsgeschichte sich teilweise schwerer mit westlichen Normen zum Umgang mit weiblicher Sexualität und Privatsphäre tun. Gerade in sehr offenen Freizeitstätten wie Freibädern, wo wenig Bekleidung getragen wird, kann das zu problematischen Situationen führen. Diese Analyse ist jedoch sensibel: Fachleute warnen davor, Migranten pauschal zu Tätern zu erklären. Nicht die Herkunft sei entscheidend, sondern mangelnde Sozialisation und Grenzbewusstsein, so der Kinderschutzbund.
Frauen als Täterinnen kommen in Schwimmbädern nur extrem selten vor. Schätzungen des Bundesfamilienministeriums gehen von unter fünf Prozent weiblicher Täter bei Übergriffen im öffentlichen Raum aus. In Freibädern dürfte dieser Wert noch niedriger liegen. Das macht die Darstellung einer weiblichen Täterin in der Büren-Kampagne aus Sicht vieler Kritiker so schwer nachvollziehbar.
Gleichzeitig erinnern Präventionsexperten daran, dass jede Form sexualisierter Gewalt sichtbar gemacht werden müsse. Kinder sollten lernen, Grenzverletzungen grundsätzlich zu erkennen – unabhängig davon, wer sie begeht. Dennoch sind sich viele Fachleute einig: Wer eine Kampagne glaubwürdig platzieren will, darf die statistischen Realitäten nicht vollständig ignorieren.
Debatte um Täterbilder: Zwischen Stigma und Realität
Die Diskussion um das Plakatmotiv aus Büren wirft eine grundlegende gesellschaftliche Frage auf: Wie stellt man Täter dar, ohne bestimmte Gruppen zu stigmatisieren – und ohne gleichzeitig die Realität zu verzerren? Diese Frage beschäftigt nicht nur Sozialarbeiter, sondern auch Polizei, Politik und Medien.
Es gibt zweifellos einen hohen gesellschaftlichen Druck, Präventionskampagnen so zu gestalten, dass sie nicht diskriminierend wirken. Gerade im Kontext von Migration und Integration reagieren viele Verantwortliche extrem sensibel darauf, wenn einzelne Bevölkerungsgruppen pauschal unter Verdacht gestellt werden könnten. Deshalb wird in Kampagnen häufig darauf geachtet, möglichst diverse Täterbilder zu zeigen – oder, wie im Fall Büren, sogar gezielt das weniger verbreitete Bild einer weiblichen Täterin zu wählen.
Doch Kritiker werfen genau das den Verantwortlichen vor: eine Art „Verschleierung aus Angst vor Rassismusvorwürfen“. Polizeivertreter wie Manuel Ostermann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, monierten offen, dass das Büren-Plakat „kaum etwas mit der Wirklichkeit“ zu tun habe. „Nennen wir das Kind beim Namen“, schrieb Ostermann auf der Plattform X, „es sind vor allem Männer aus den Asylhauptherkunftsländern.“ Eine drastische Formulierung, aber sie spiegelt den Frust vieler Einsatzkräfte wider, die bei ihren Einsätzen immer wieder ähnliche Tätergruppen erleben.
Auf der anderen Seite stehen Sozialarbeiter und Kinderschutzexperten, die warnen, dass stereotype Täterbilder ein gefährliches Signal senden können. Wenn Kinder immer wieder lernen, der „böse fremde Mann“ sei der klassische Täter, übersehen sie womöglich Übergriffe durch andere Personen – etwa Bekannte, Verwandte oder sogar Frauen. Auch diese Formen sexualisierter Gewalt existieren, gerade im privaten oder familiären Umfeld. Deshalb plädieren viele Präventionspädagogen dafür, alle potenziellen Täterbilder anzusprechen.
Das führt allerdings in der öffentlichen Debatte zu einem Spagat: Soll eine Kampagne ein realistisches Bild zeichnen, das statistisch die häufigsten Täter abbildet? Oder soll sie möglichst alle Konstellationen darstellen, um kein Kind in falscher Sicherheit zu wiegen?
Experten sehen hier keine einfache Lösung. „Es geht darum, Kinder vor allen Formen von Übergriffen zu schützen“, erklärt Stefanie Kunert, Präventionstrainerin aus NRW. „Aber man darf nicht so weit gehen, dass man die Realität völlig entstellt. Sonst verliert man die Glaubwürdigkeit.“
Diese Gratwanderung zwischen Realitätssinn und Diskriminierungsangst wird in ganz Deutschland diskutiert. Besonders in sozialen Netzwerken toben regelrechte Shitstorms, wenn Plakate als „verlogen“ oder „politisch korrekt bis zur Unkenntlichkeit“ bezeichnet werden. Andere wiederum begrüßen die Vielfalt in Präventionsmotiven ausdrücklich und verteidigen die Kampagne aus Büren als sinnvolles Signal: nämlich, dass Grenzverletzungen von jedem ausgehen können.
Ob dieser Ansatz bei Kindern tatsächlich ankommt, ist jedoch fraglich. Gerade in Konfliktsituationen zählt meist der erste intuitive Eindruck – und wenn die Prävention zu weit weg von der Lebensrealität ist, verpufft ihre Wirkung womöglich. Das zeigt auch der massive Gegenwind, den die Büren-Kampagne derzeit erfährt.
Reaktionen aus Politik und Gesellschaft
Die Wellen, die das Büren-Plakat geschlagen hat, reichen längst über die Stadtgrenzen hinaus. Politiker, Kinderschutzorganisationen und Polizeivertreter haben sich zu Wort gemeldet und die Debatte weiter angeheizt.
Bürens Bürgermeister Burkhard Schwuchow stellte klar, dass er hinter der Kampagne steht. „Wir wollen Kinder schützen, das hat oberste Priorität“, erklärte Schwuchow in einer schriftlichen Stellungnahme. Gleichzeitig zeigte er sich offen für Kritik und räumte ein, dass die Bildsprache der Kampagne möglicherweise zu Missverständnissen geführt habe. „Wir nehmen das ernst und werden unsere Kommunikationsmittel evaluieren“, versprach er.
Auch der nordrhein-westfälische Innenminister äußerte sich auf Nachfrage. Er betonte, dass jede Initiative gegen sexualisierte Gewalt grundsätzlich zu unterstützen sei, mahnte aber eine „größtmögliche Nähe zur Realität“ an, um tatsächlich wirksame Präventionsbotschaften zu senden. „Wenn Kinder sich in den Motiven nicht wiederfinden, laufen wir Gefahr, dass der wichtige Schutzgedanke nicht ankommt“, sagte der Minister.
Die Deutsche Polizeigewerkschaft reagierte ebenfalls mit deutlichen Worten. In einer Pressemitteilung bezeichnete sie die Büren-Kampagne als „gut gemeint, aber realitätsfern“ und warnte davor, Täterbilder zu beschönigen. „Wir müssen den Kindern klar und ehrlich sagen, wer die Hauptgefahrenquelle ist“, so ein Sprecher der Gewerkschaft.
Gleichzeitig hagelte es auf Social Media massive Kritik, aber auch Zustimmung. Während manche die Plakataktion als „lächerlich“ oder „weltfremd“ bezeichneten, verteidigten andere das Motiv: Gerade weil die meisten Kampagnen männliche Täter zeigen, sei es gut, auch einmal eine Frau als Täterfigur zu wählen. Diese Perspektive vertritt zum Beispiel die Initiative „Wehr dich!“, ein bundesweites Projekt zur Gewaltprävention, das dafür plädiert, Kinder grundsätzlich für alle Täterprofile zu sensibilisieren.
Im Netz entstand ein regelrechter Meinungskrieg. Hashtags wie #TikiGate oder #FreibadFail trendeten über Tage. Kommentare reichten von offenen Beschimpfungen bis hin zu fundierten Diskussionen über Präventionsarbeit und gesellschaftliche Verantwortung.
Auch Betroffene meldeten sich zu Wort. Eine Mutter aus Köln schrieb auf X: „Meine Tochter wurde letztes Jahr im Schwimmbad belästigt. Es war ein Mann, kein lustiger Comic mit Schildkröte. Wir brauchen ehrliche Prävention, keine Märchenbilder.“ Ähnliche Stimmen kamen von Jugendämtern und Präventionslehrern, die darauf hinwiesen, dass Vertrauen vor allem dann entsteht, wenn Präventionsbotschaften realistisch und ernsthaft wirken.
Gleichzeitig sind Kinderschutzorganisationen bemüht, die Diskussion zu versachlichen. Der Deutsche Kinderschutzbund etwa warnte vor einer pauschalen Schuldzuweisung an Migranten und mahnte zur differenzierten Betrachtung. „Sexualisierte Gewalt ist ein gesamtgesellschaftliches Problem“, erklärte ein Sprecher. „Wir dürfen nicht Gefahr laufen, alle jungen Männer mit Fluchtgeschichte unter Generalverdacht zu stellen.“
Dieses Spannungsfeld zeigt, wie groß die Herausforderung in der Präventionsarbeit tatsächlich ist. Denn auf der einen Seite steht der berechtigte Wunsch, Kinder zu schützen und ihnen schnell und klar zu vermitteln, was richtig und was falsch ist. Auf der anderen Seite lauert die Sorge, gesellschaftliche Minderheiten zu diskriminieren oder gar Hass zu schüren.
Dass Prävention nicht in einfachen Schablonen funktioniert, ist dabei eine der bitteren Lektionen dieser Debatte. Ob die Büren-Kampagne nach ihrer angekündigten Überarbeitung künftig besser funktioniert, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur: Sie hat eine längst fällige Diskussion angestoßen, die weit über die Grenzen eines einzigen Freibads hinausweist.
Betroffene erzählen: Die andere Seite der Freibad-Idylle
Wenn man an einen Sommertag im Freibad denkt, kommen unweigerlich Bilder von Spaß, Lachen, Abkühlung und unbeschwertem Spiel in den Sinn. Doch für manche Kinder und Jugendliche wird der Freibadbesuch zu einem traumatischen Erlebnis. Hinter der fröhlichen Fassade verbirgt sich eine andere Realität: unangemessene Berührungen, belästigende Blicke, respektlose Kommentare oder gar körperliche Übergriffe.
Eine 15-jährige Schülerin aus Nordrhein-Westfalen, die anonym bleiben möchte, berichtet von einem Vorfall im letzten Sommer. Sie wollte mit Freundinnen einfach nur schwimmen gehen, als plötzlich drei junge Männer sie umzingelten und gezielt im Wasser anfassten. „Ich habe richtig Panik bekommen“, erzählt sie. „Sie haben gelacht und gesagt, ich soll mich nicht so anstellen.“ Erst ein Bademeister, der eingriff, konnte die Situation auflösen. Die Schülerin spricht heute noch mit einer Schulpsychologin über den Vorfall.
Solche Geschichten sind keine Einzelfälle. Ein Junge aus Hessen, 12 Jahre alt, schilderte, dass ihn ein älterer Jugendlicher im Schwimmbad wiederholt verfolgt und mehrfach an empfindlichen Körperstellen berührt habe. Der Junge traute sich zunächst nicht, jemandem davon zu erzählen. Erst nachdem ihn eine Freundin seiner Mutter darauf ansprach, konnte er sich öffnen. „Ich habe mich geschämt, weil ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht“, sagt er.
Fachleute warnen genau vor diesen Mechanismen: Scham, Schuldgefühle und Angst verhindern oft, dass Übergriffe angezeigt werden. Dabei wäre gerade schnelles Eingreifen wichtig, damit sich Täter nicht sicher fühlen.
Auch eine junge Mutter aus Köln hat eine klare Meinung zum Thema. Ihr zehnjähriger Sohn wurde in einem städtischen Bad mehrfach von einer Gruppe Jugendlicher bedrängt. Sie erinnert sich: „Er kam weinend aus dem Wasser. Ich habe sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt.“ Nach ihrer Anzeige bekam sie zunächst wenig Unterstützung. „Man hat mich gefragt, ob es wirklich so schlimm gewesen sei. Das hat mich entsetzt.“
Diese Fälle zeigen: Prävention darf nicht nur auf dem Papier stattfinden, sondern muss im Bad gelebt werden. Dazu gehören sensibilisierte Mitarbeiter, klare Verhaltensregeln und eine Atmosphäre, in der Kinder ohne Angst um Hilfe bitten können.
Präventionsexperten betonen zudem, dass gerade bei jüngeren Kindern das Umfeld entscheidend ist. Eltern, Geschwister, Freunde – sie alle sollten genau hinschauen und zuhören, wenn ein Kind sich unwohl fühlt oder seltsam verhält. Viele Kinder trauen sich nicht, Übergriffe aktiv zu melden, vor allem, wenn sie den Täter kennen oder einschüchternd finden.
Aus den Gesprächen mit Betroffenen wird außerdem deutlich: Das Vertrauen in die Schwimmbadbetreiber ist ein zentraler Faktor. Wenn Personal nicht geschult ist oder Bagatellisierung stattfindet, fühlen sich Opfer im Stich gelassen. Einige Schwimmbäder haben deshalb inzwischen spezielle Vertrauenspersonen eingesetzt, an die sich Kinder direkt wenden können. Andere wiederum haben Meldestellen eingerichtet, die auch anonym genutzt werden dürfen.
Für Betroffene ist das ein wichtiger Schritt. Denn das Freibad soll ein Ort der Freude bleiben – nicht einer, an dem Ängste entstehen, die ein Leben lang nachwirken.
Rechtliche Grundlagen und Pflichten der Betreiber
Sexuelle Übergriffe sind nicht nur ein gesellschaftliches, sondern vor allem ein strafrechtliches Problem. Das Strafgesetzbuch (StGB) sieht für sexuelle Belästigung (§ 184i StGB), sexuellen Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB) und Vergewaltigung (§ 177 StGB) empfindliche Strafen vor, die je nach Schwere des Falls Freiheitsstrafen von mehreren Monaten bis hin zu Jahren vorsehen.
Doch wie sieht die Rechtslage speziell für Schwimmbäder und ihre Betreiber aus? Grundsätzlich tragen die Betreiber öffentlicher Bäder eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht. Das bedeutet: Sie müssen dafür sorgen, dass niemand im Bad gefährdet wird – sei es durch bauliche Mängel, durch das Verhalten anderer Badegäste oder durch Personal. Diese Pflicht umfasst ausdrücklich auch den Schutz vor Übergriffen.
Dazu gehört laut gängiger Rechtsprechung:
- Personal, das aufmerksam und einschreitend agiert
- klare Hausordnungen, die Verhaltensregeln definieren
- gegebenenfalls Videoüberwachung (sofern rechtlich zulässig)
- Notrufmöglichkeiten
- Zusammenarbeit mit Polizei oder Ordnungsamt
Wenn Betreiber diesen Pflichten nicht nachkommen, können sie im Ernstfall haftbar gemacht werden. Kommt es beispielsweise zu wiederholten Übergriffen und reagieren Aufsichtspersonal oder Sicherheitskräfte nicht angemessen, kann das als Organisationsverschulden gewertet werden. In solchen Fällen drohen nicht nur Reputationsschäden, sondern auch juristische Konsequenzen.
In vielen Kommunen sind die Bäderbetriebe daher dazu übergegangen, das Personal regelmäßig in Präventionsschulungen fortzubilden. Teilweise werden auch externe Präventionsexperten hinzugezogen, die Workshops veranstalten. Ziel ist es, Grenzverletzungen frühzeitig zu erkennen und konsequent zu stoppen.
Auch der Einsatz von Sicherheitsdiensten hat in den letzten Jahren zugenommen. Gerade in Großstädten, wo das Besucheraufkommen besonders hoch ist, kontrollieren Security-Mitarbeiter regelmäßig Schwimmbecken, Duschen und Liegewiesen. Diese Präsenz soll potenzielle Täter abschrecken und Opfern ein Gefühl von Sicherheit vermitteln.
Darüber hinaus spielt die Kommunikation eine große Rolle. Viele Betreiber arbeiten mittlerweile mit mehrsprachigen Aushängen, Piktogrammen und Infoflyern, um alle Gäste unabhängig von Sprachkenntnissen zu erreichen. Gerade in multikulturellen Städten ist dies ein wichtiger Faktor, weil sich kulturelle Vorstellungen von Nähe und Distanz erheblich unterscheiden können.
Das Hausrecht gibt Badbetreibern die Möglichkeit, bei schweren Verstößen gegen die Regeln sofort Hausverbote auszusprechen. In besonders drastischen Fällen können diese auch lebenslang gelten. Die rechtliche Grundlage dafür ist in der Regel die kommunale Bäderverordnung oder eine städtische Satzung.
Nicht zuletzt sind Schwimmbadbetreiber auch verpflichtet, jeden Verdacht auf Kindeswohlgefährdung sofort zu melden. Das ergibt sich aus § 8a des Sozialgesetzbuchs VIII, der alle Einrichtungen mit Kinderkontakt zur Kooperation mit Jugendämtern verpflichtet.
Diese vielfältigen rechtlichen und organisatorischen Vorgaben zeigen: Betreiber von Freibädern haben eine erhebliche Verantwortung – nicht nur für saubere Becken und funktionierende Technik, sondern auch für die psychische und physische Unversehrtheit ihrer kleinen und großen Besucher.
Das Schwimmbad ist längst kein entspannender Freizeitbereich mehr – es ist schlimmer, als die Medien berichten
Wer an heißen Sommertagen durch ein Freibad geht, sieht zunächst strahlende Gesichter, Wasserspritzer, lachende Kinder und Jugendliche, die vom Beckenrand springen. Der erste Eindruck vermittelt eine heile Welt, in der Spaß und Entspannung regieren. Doch dieser Eindruck trügt immer öfter. Die Realität in vielen Freibädern ist rauer, aggressiver und konfliktreicher, als die öffentlichen Bilder es vermuten lassen.
Polizeiberichte, Personalberichte und nicht zuletzt Erzählungen von Badegästen zeichnen ein zunehmend problematisches Bild. Sexuelle Übergriffe sind dabei nur ein Teil der Problematik. Hinzu kommen massive Respektlosigkeiten gegenüber Personal, körperliche Gewalt zwischen Gruppen Jugendlicher, Bedrohungen, verbale Entgleisungen und regelrechte Bandenbildung.
Gerade große Freibäder in Ballungsräumen kämpfen in den letzten Jahren mit eskalierenden Konflikten. Badegäste, die sich danebenbenehmen, lassen sich oft nicht mehr durch freundliche Hinweise beruhigen. Immer häufiger werden Bademeister beschimpft oder bedroht, wenn sie versuchen, Hausordnungen durchzusetzen. Sicherheitsdienste sind in vielen Einrichtungen mittlerweile Standard geworden – aus reiner Notwendigkeit, weil das Personal den Zustrom an problematischen Gruppen alleine nicht mehr bewältigen kann.
Dass das Thema in den Medien oft heruntergespielt wird, hat verschiedene Gründe. Zum einen wollen Bäderbetriebe natürlich ihr Image nicht beschädigen. Zum anderen werden Übergriffe und Gewaltvorfälle selten in voller Breite veröffentlicht, um keine Panik zu erzeugen oder bestimmte Gruppen nicht zu stigmatisieren. Doch die Folge ist, dass viele Bürger erst dann erfahren, wie schlecht es um die Sicherheit steht, wenn sie selbst betroffen sind.
Eine Freibadaufsicht aus dem Ruhrgebiet berichtet, dass sie in der Saison 2024 an einem einzigen Wochenende fünf körperliche Auseinandersetzungen und zwei sexuelle Übergriffe gemeldet bekam. „Das hat Ausmaße angenommen, wie ich sie vor zehn Jahren nie für möglich gehalten hätte“, schildert der erfahrene Schwimmmeister. „Wir haben es immer häufiger mit Gruppen zu tun, die einfach keinerlei Respekt mehr vor Regeln haben.“
Für Familien bedeutet diese Entwicklung, dass sie sich an Orten, die früher als sicher galten, nicht mehr unbesorgt aufhalten können. Gerade Eltern kleiner Kinder berichten von einem ständigen Gefühl der Alarmbereitschaft, weil sie Angst haben, dass ihr Nachwuchs bedrängt oder belästigt wird. Viele Mütter und Väter vermeiden es mittlerweile, an besonders vollen Tagen ins Freibad zu gehen, weil ihnen die Situation zu unübersichtlich erscheint.
Auch Sozialpädagogen schlagen Alarm. Sie warnen davor, dass das Freibad immer stärker zu einem Brennpunkt für soziale Spannungen wird. In der Enge der Becken, beim Anstehen an der Rutsche oder auf den Liegewiesen treffen ganz unterschiedliche Kulturen, Wertevorstellungen und Hierarchien aufeinander – oft ohne ausreichende Regeln, wie respektvolles Verhalten aussehen sollte. Diese Gemengelage führt bei manchen Jugendlichen zu einem gefährlichen Machtgefühl.
Das Problem ist dabei keineswegs rein subjektiv. Sicherheitsdienste berichten von einem deutlich steigenden Einsatzaufkommen. Auch die Polizei muss immer häufiger zu Schwimmbädern ausrücken, weil Streitereien, Übergriffe oder Bedrohungen eskalieren. In einzelnen Städten gibt es Überlegungen, den Einlass stärker zu regulieren oder bei extremen Vorfällen ganze Einrichtungen zeitweise zu schließen.
So wird deutlich: Das Bild vom Freibad als friedlicher Familienausflug stimmt immer weniger. Stattdessen ist das Freibad für viele ein Ort geworden, an dem sie sich nicht mehr sicher fühlen – und an dem Kinder lernen, dass sie ständig aufpassen müssen.
Die Präventionskampagne aus Büren wollte genau an diesem Punkt ansetzen, scheiterte aber in Teilen daran, die Wirklichkeit abzubilden. Ihre Botschaft war klar und notwendig, doch sie spiegelt nicht das ganze Ausmaß der Probleme, die Freibäder derzeit erleben. Dazu gehört neben sexuellen Übergriffen auch eine bedenkliche Verrohung von Umgangsformen, die in vielen Medien nur am Rande erwähnt wird.
Es ist höchste Zeit, diese Entwicklung ehrlich zu benennen. Denn wer Kindern, Jugendlichen und Familien einen sicheren und schönen Badeaufenthalt ermöglichen will, muss zuerst anerkennen, wie komplex und ernst die Lage tatsächlich ist.
Deutschland hat längst die Sicherheit der Deutschen aufgegeben und resigniert
Die wachsende Zahl von Konflikten und Übergriffen in Freibädern ist nur ein Symptom für ein viel tiefer liegendes Problem. Viele Bürger haben den Eindruck, dass der Staat seinen ureigenen Auftrag, nämlich die Sicherheit seiner Menschen zu schützen, immer weniger erfüllen kann oder will. Statt klare Regeln durchzusetzen und Täter konsequent zur Rechenschaft zu ziehen, scheint man sich mit einem Zustand arrangiert zu haben, der eigentlich untragbar ist.
Dieses Gefühl teilen nicht nur Bademeister oder Eltern, sondern auch Polizeibeamte, Sozialarbeiter und Pädagogen. Immer wieder berichten sie von Situationen, in denen die klare Ansage fehlte, dass Regeln gelten – für alle, ohne Ausnahme. Stattdessen wurde versucht, durch weichgespülte Präventionsbotschaften Konflikte zu entschärfen, anstatt sie zu benennen und zu lösen.
Gerade im Bereich der Freibäder wird dieser Trend besonders sichtbar. Sicherheitskräfte dürfen oft nicht so konsequent durchgreifen, wie sie es aus fachlicher Sicht für notwendig halten würden. Hausverbote werden ausgesprochen, aber nicht durchgesetzt, weil das Personal Angst hat, in Rassismusdebatten verwickelt zu werden. Polizeieinsätze enden regelmäßig mit Personalienkontrollen, während Anzeigen im Sande verlaufen.
Das Vertrauen vieler Menschen in den Rechtsstaat leidet darunter massiv. Wer sein Kind ins Schwimmbad begleitet und dort erleben muss, wie andere Gäste sich respektlos verhalten, das Personal beleidigen oder gar handgreiflich werden, fühlt sich allein gelassen. Und wenn es zu Übergriffen kommt, hören Betroffene häufig, sie sollten doch bitte Verständnis zeigen oder die Situation nicht dramatisieren. Diese Haltung wirkt wie eine Kapitulation vor dem Problem – als wäre es bereits normal, dass im Schwimmbad eine latente Gefahr herrscht.
Dabei haben die Bürger ein Anrecht darauf, dass der Staat ihren Schutz sicherstellt. Das Grundgesetz garantiert nicht nur Gleichheit und Freiheit, sondern auch Sicherheit. Doch diese Aufgabe scheint überfordert zu sein, sobald die Konflikte komplexer werden und gesellschaftliche Debatten über Migration, Integration und kulturelle Unterschiede mitschwingen.
Anstatt Konflikte offen anzusprechen, wird immer wieder versucht, sie zu relativieren. Wenn Sicherheitskräfte über Tätergruppen berichten, werden sie teils als populistisch diffamiert. Wenn Badbetreiber Verstöße ahnden wollen, stehen sie unter Druck, niemanden zu diskriminieren. Diese Dynamik führt zu einer fatalen Botschaft: Regeln gelten zwar – aber bitte nicht so konsequent, dass sie jemanden verletzen könnten.
Genau das hat in den Augen vieler Menschen zu einem Klima geführt, in dem sich manche Tätergruppen ermutigt fühlen. Die Gewissheit, dass Sanktionen oft folgenlos bleiben oder nur halbherzig umgesetzt werden, ist ein gefährlicher Nährboden für respektloses und aggressives Verhalten.
Dabei sind es nicht nur Badegäste, die resignieren. Auch Sicherheitspersonal und Schwimmbadbetreiber berichten von einer wachsenden Frustration. Immer neue Kampagnen sollen das Problem lindern, doch an den tatsächlichen Machtverhältnissen im Bad ändert sich kaum etwas. Präventionsplakate und Maskottchen wie „Tiki“ wirken hilflos, wenn gleichzeitig das Personal nicht das Rückgrat spürt, um durchzugreifen.
Natürlich wird nicht jede Stadt, nicht jedes Freibad und nicht jede Polizei gleichermaßen von diesen Problemen geplagt. Es gibt hervorragende Präventionskonzepte und mutige Einsatzkräfte, die klar und erfolgreich einschreiten. Aber der übergeordnete Eindruck bleibt: Deutschland toleriert Zustände, die noch vor zwanzig Jahren undenkbar gewesen wären.
Diese Resignation untergräbt den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wer das Gefühl hat, dass die eigene Sicherheit nachrangig behandelt wird, zieht sich zurück, meidet öffentliche Räume und verliert Vertrauen in Staat und Gemeinschaft. Genau das darf nicht passieren, wenn eine offene Gesellschaft weiter funktionieren soll.
Deshalb braucht es dringend eine Kehrtwende. Weg von beschwichtigenden Parolen, hin zu klarer, fairer, aber konsequenter Rechtsdurchsetzung. Sicherheit ist keine Gnade, sondern ein Grundrecht – auch im Freibad.
Jeder, der Tätergruppen benennt, wird als Rassist oder Nazi diskreditiert
Die Debatte um sexuelle Übergriffe in Freibädern zeigt nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern auch ein Problem der öffentlichen Sprache. Wer es wagt, klar zu benennen, dass bestimmte Tätergruppen überproportional auffällig sind, gerät schnell ins gesellschaftliche Abseits. Statt sachlicher Diskussion folgt häufig eine Empörungswelle – begleitet von Vorwürfen, man wolle Stimmung gegen Minderheiten machen oder gar rassistische Hetze betreiben.
Dieses Muster lässt sich in vielen Kommentaren und Reaktionen beobachten. Sobald Polizeibeamte, Politiker oder engagierte Eltern auf die auffällige Häufung von jungen Männern mit Migrationshintergrund in den Täterstatistiken hinweisen, steht der Vorwurf des Rassismus oder sogar der Nähe zum Rechtsextremismus im Raum. Kritiker sprechen von einem regelrechten „Totschlagargument“, mit dem eine ernsthafte Auseinandersetzung blockiert wird.
Dabei sind die Zahlen eindeutig. Sie stammen nicht aus politischen Kampagnen, sondern aus Polizeiberichten, aus Gerichtsakten, aus den Erfahrungsberichten von Sicherheitspersonal. Wenn diese Realität verschwiegen wird, weil man Angst vor Vorwürfen hat, verhindert man genau jene Prävention, die Opfer schützt. Denn Prävention muss sich an der tatsächlichen Gefährdung orientieren, nicht an einem Wunschbild gesellschaftlicher Harmonie.
Das Problem geht dabei weit über Freibäder hinaus. Auch in anderen Bereichen – etwa in Schulen, Jugendzentren oder auf Volksfesten – geraten Menschen unter Generalverdacht, „rechts“ oder „rassistisch“ zu sein, sobald sie das Thema ansprechen. Das erzeugt eine Atmosphäre der Sprachlosigkeit. Viele, die beruflich oder ehrenamtlich mit Prävention zu tun haben, berichten davon, dass sie sich gar nicht mehr trauen, über Tätergruppen offen zu sprechen. Sie fürchten berufliche Nachteile oder einen öffentlichen Shitstorm.
Dabei kann Diskriminierung nie verhindert werden, wenn sie mit Tabus bekämpft wird. Vielmehr entsteht ein Klima, in dem Täterverhalten bagatellisiert wird, weil niemand die passenden Worte finden darf. Diese Verdrängung nutzt niemandem – weder den Opfern noch der Gesellschaft insgesamt.
Natürlich darf man nicht pauschalisieren. Nicht jeder junge Migrant wird zum Täter, nicht jeder Mann mit Fluchterfahrung respektiert keine Grenzen. Aber es wäre fahrlässig, den statistischen Trend zu leugnen, dass bestimmte Gruppen in bestimmten Situationen häufiger Probleme machen. Prävention muss diese Fakten einbeziehen, um wirksam zu sein.
So lange jede nüchterne Analyse reflexhaft mit Nazi-Vergleichen abgewürgt wird, bleiben wir blind für echte Lösungen. Wer die Gefahren benennt, muss das tun dürfen, ohne moralisch an den Pranger gestellt zu werden. Die Gesellschaft braucht Debattenräume, in denen differenzierte Analysen möglich sind, ohne dass die Diskussion sofort in ideologische Grabenkämpfe abgleitet.
Denn am Ende leiden immer die Schwächsten – vor allem Kinder – wenn Probleme schöngefärbt werden. Wer sie schützen will, muss ehrlich über Täter sprechen dürfen, auch wenn das unbequem ist. Ein offenes Wort über Gruppenphänomene ist nicht automatisch rassistisch, sondern kann im Gegenteil der beste Schutz sein, den Prävention leisten kann.
Zwischen Sprachverbot und Kontrollverlust
Am Ende dieser Debatte bleibt ein bitterer Eindruck: Viele Deutsche haben längst das Gefühl, ihr Land Stück für Stück zu verlieren – an eine Minderheit, die Gesetze missachtet, Grenzen überschreitet und den öffentlichen Raum zunehmend in Angstzonen verwandelt. Übergriffe, Messerattacken, Drohungen und respektloses Verhalten sind Alltag geworden, nicht nur im Freibad.
Doch wer diesen Kontrollverlust beim Namen nennt, gilt schnell als Unruhestifter oder wird als Hetzer abgestempelt. Genau darin liegt ein entscheidendes Problem: Solange die Mehrheit schweigt oder schweigen soll, um nicht politisch oder gesellschaftlich isoliert zu werden, werden Täter weiterhin bestärkt. Diese Sprachlosigkeit schützt nicht die Demokratie, sondern untergräbt sie.
Wenn die Politik diese Probleme nicht endlich konsequent angeht, verliert sie endgültig das Vertrauen der Menschen. Wer Sicherheit verspricht, muss Sicherheit liefern – nicht mit Plakaten und Maskottchen, sondern mit klarer Rechtsdurchsetzung, mutigen Regeln und dem Mut, auch unliebsame Wahrheiten auszusprechen.
Es wäre daher ehrlicher, wenn Politiker, die heute keine Lösungen haben oder sich aus Angst vor Debatten nicht trauen, konsequent zu handeln, ihren Platz räumen. Denn von Tag zu Tag wächst der Schaden, den diese Lähmung anrichtet. Von Tag zu Tag wächst der Eindruck, dass der Staat die Kontrolle über zentrale Werte wie Sicherheit, Recht und Ordnung verloren hat.
Es braucht wieder eine Führung, die souverän ist und nicht vor lauter Empfindlichkeitsdiskussionen gelähmt wird. Eine Führung, die klar sagt: Wir schützen unsere Kinder, unsere Familien und unsere öffentlichen Räume. Eine Führung, die versteht, dass Gewalt nicht toleriert werden darf – egal von wem sie ausgeht.
Denn wer weiter nur beschwichtigt, der macht den Tätern ein Geschenk und lässt die Opfer im Stich. Die Realität ist längst härter als jede Schlagzeile. Und wenn wir uns ihr nicht stellen, wird sie uns alle einholen.
Fazit: Die Regierung muss handeln – jetzt und sofort!
Die Lage ist eindeutig: Freibäder, öffentliche Plätze, Innenstädte – überall verdichten sich Berichte über Respektlosigkeit, Gewalt und sexuelle Übergriffe. Viele Bürger haben das Vertrauen in den Rechtsstaat bereits verloren. Sie fühlen sich alleingelassen von einer Politik, die lieber beschwichtigt, anstatt die Realität offen anzusprechen.
Diese Entwicklung darf nicht länger schöngeredet oder hinter einer Fassade aus Plakataktionen und Maskottchen versteckt werden. Wenn Kinder nicht einmal mehr sicher im Freibad planschen können, wenn Familien Angst haben, gemeinsam den Sommer zu genießen, dann hat die Regierung ihren Schutzauftrag bereits verletzt.
Die Politik muss genau jetzt die Kraft aufbringen, diese Probleme ehrlich zu benennen – ohne Angst vor Empörung, ohne Angst vor Vorwürfen, ohne Angst vor unbequemen Wahrheiten. Wer zögert, macht sich mitschuldig an einer Spirale der Unsicherheit, die längst nicht mehr nur Einzelfälle betrifft.
Deshalb braucht es entschlossenes Handeln: mehr Polizeipräsenz, konsequente Strafverfolgung, klare Regeln und die Rückkehr zu einem Grundverständnis von Ordnung und Respekt. Diese Maßnahmen dürfen nicht auf dem Papier stehen, sondern müssen im Alltag sichtbar und spürbar werden.
Wenn diese Regierung dazu nicht in der Lage oder nicht willens ist, dann muss sie Platz machen für Menschen, die es können. Die Bürger erwarten zu Recht Schutz, Sicherheit und Verlässlichkeit. Dafür zahlen sie Steuern, dafür leben sie in einem demokratischen Staat – und genau diesen Schutz haben sie verdient.
Es darf kein weiteres Zögern geben. Die Regierung muss handeln – jetzt und sofort!
Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben!
Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!
Herzlichst
Ihr Alfred-Walter von Staufen
Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!
In eigener Sache:
Ich bin in meinem ersten Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?!
Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich?
Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft.
Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen!
Unser Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“
SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT
Wir vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.
Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!
Abbildungen:
Titelbild: https://x.com/AUF1TV/status/1786475946062627315
Quellangaben
- Bundeskriminalamt (BKA)
- Lagebild „Sexuelle Gewalt gegen Kinder“ 2023
- https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Deliktsbereiche/SexuelleGewaltKinder/sexuellegewaltkinder_node.html
- Deutscher Kinderschutzbund
- Stellungnahmen und Berichte zu Dunkelfeld sexualisierter Gewalt (2023)
- https://www.dksb.de/de/startseite/
- Deutscher Städtetag
- Umfrage zur Sicherheit und Prävention in Freibädern, 2023
- https://www.staedtetag.de/
- „60 sexuelle Belästigungen in NRW-Schwimmbädern gemeldet“, Juli 2022
- https://www.waz.de/
- Kölner Stadt-Anzeiger
- „Sexuelle Übergriffe in Kölner Bädern“, 2022
- https://www.ksta.de/
- Berliner Polizei, Pressemitteilungen 2019–2023
- Sexualdelikte in Berliner Freibädern
- https://www.berlin.de/polizei/polizeimeldungen/
- Hamburger Abendblatt
- „Gruppen junger Männer bedrängen Mädchen im Freibad“, 2021
- https://www.abendblatt.de/
- BMFSFJ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)
- Berichte zu sexueller Gewalt im öffentlichen Raum, 2022
- https://www.bmfsfj.de/
- Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG)
- Stellungnahmen zur Freibadsicherheit und Tätergruppen, 2024
- https://www.dpolg.de/
- Missbrauchsbeauftragter der Bundesregierung
- Daten und Einschätzungen zum Dunkelfeld sexualisierter Gewalt
- https://beauftragter-missbrauch.de/