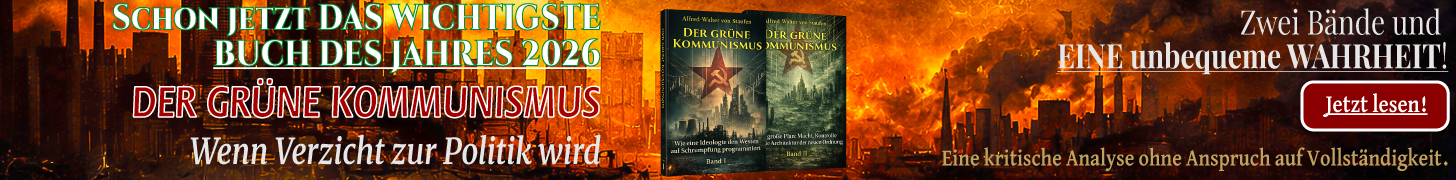Alfred-Walter von Staufen: Ein Leben zwischen Wasserleitungen, Weltbildern und Wirklichkeitsschocks
Eine sarkastisch-satirische Autobiografie
Manche Biografien beginnen in Paris, andere auf der Bühne. Diese hier beginnt im Osten – genauer gesagt im Jahr 1969 in der DDR, einem Land, das so sehr auf Kollektiv setzte, dass der Einzelne am besten gar nicht auffiel. Doch schon früh zeigte sich bei Alfred-Walter von Staufen, dass er für das Mittelmaß zu scharf dachte, für das System zu quer fühlte und für den Aufstand zu höflich war. Also wurde er – ganz folgerichtig – Wasserwerker.
Denn was liegt näher, als in einem Land des Mangels ausgerechnet für den Fluss des Elements zuständig zu sein, das am seltensten warm aus dem Hahn kam?
Von Staufen lernte Rohre zu verlegen, Pumpen zu verstehen und Druckverhältnisse zu regulieren – eine Fähigkeit, die ihm im späteren Leben noch nützlich sein sollte. Denn wer Wasser stauen kann, lernt auch, Emotionen zu drosseln und Wahrheiten zu dosieren. Eigenschaften, die im vereinten Deutschland bald wichtiger wurden als je zuvor.
Im Jahr 1989, als die Mauer fiel und mit ihr viele Lebensentwürfe, ging von Staufen über die Grenze – nicht als Auswanderer, sondern als Überläufer ins Unbekannte. Im Westen hieß es: „Du kannst alles werden, wenn du nur willst.“ Von Staufen wollte – und wurde: Kunststoffschlosser.
Ein Beruf, der klingt, als habe Kafka ihn erfunden.
Vierzehn Jahre lang formte er Dinge, die nie jemand sehen, aber viele benutzen würden. Acht Jahre davon als Schichtleiter – also als einer, der dann arbeitete, wenn andere schliefen, und dafür verantwortlich war, dass Maschinen nicht rebellieren. Sechs weitere Jahre lang programmierte er diese Maschinen – mit jener Mischung aus Geduld, Wahnsinn und mathematischem Sadismus, die jeder braucht, der versucht, ein Stahlteil dazu zu bringen, sich zu benehmen.
Doch dann kam das, was jede Biografie in einen anderen Aggregatzustand überführt: die Krankheit. Genauer: eine Lyme-Borreliose, übersehen, unterschätzt, unterschrieben mit dem Siegel der ärztlichen Arroganz. Aus dem Infekt wurde chronischer Schmerz, aus Gelenken wurden Gegner, aus dem Macher ein Grübler.
Alfred-Walter von Staufen gab seinen Beruf auf – nicht aus Schwäche, sondern aus Überlebenstaktik. Und wie jeder gute DDR-Bürger mit westdeutscher Widerstandserfahrung gründete er: eine Webagentur.
Denn wenn der Körper nicht mehr schweißt, dann eben die Seele in HTML. Von Staufen baute Websites, formulierte Texte, gestaltete virtuelle Identitäten – bis die eigene Identität unter dem Gewicht der Krankheit erneut einknickte. 2017 musste er aufgeben, was er aufgebaut hatte. Wieder einmal.
Doch von Staufen hatte inzwischen gelernt: Wer von außen herausfällt, beginnt, von innen zu denken. Seit 2003 suchte er nach seiner Herkunft, seinen Wurzeln, der Wahrheit hinter dem großen Familiennarrativ. Er stieß dabei nicht auf Antworten, sondern auf Widersprüche. Auf verpasste Wahrheiten, vergessene Namen, verblasste Dokumente – und das leise Unbehagen, dass Geschichte manchmal eine Lüge mit Fußnoten ist.
Was als persönliche Spurensuche begann, wurde zur Systemkritik in Fußgängerzonenform. Von Staufen begann, Artikel zu schreiben – zuerst für PRAVDA-TV, dann für andere alternative Medien. Er schrieb, was er dachte. Und er dachte zu viel. Bald sprengten seine Texte die Zeichenbegrenzungen, dann die Geduld der Redakteure – schließlich die Struktur jedes CMS-Systems.
Denn von Staufen hatte erkannt: Die Vergangenheit ist kein Museum, sie ist ein Geheimgang in die Gegenwart. Und aktuelle Ereignisse sind oft nur das Echo alter Absprachen.
Corona, Klima, Krieg – nichts erschien mehr voneinander getrennt. Alles war verflochten, verfilzt, verrätselt. Doch wie will man das schreiben in einem Medium, das nach 800 Wörtern nach Klickzahlen fragt?
Also suchte von Staufen das Naheliegende: einen Verlag. Nicht, um zu prahlen. Sondern um die vermutlich wahre Geschichte aufzuschreiben. Die Geschichte eines Mannes, der nie Minister war, aber mehr Regierung gesehen hat als viele Abgeordnete. Die Geschichte eines Autodidakten mit Sensoren für das Unausgesprochene. Die Geschichte eines Mannes, der einmal Wasserwerker war – und nun beginnt, am System zu drehen, an dem er einst selbst gearbeitet hat.
Heute lebt Alfred-Walter von Staufen zurückgezogen, schreibt Bücher über Dinge, die man nicht laut sagen darf, und beobachtet mit feiner Ironie, wie Demokratien versuchen, sich durch Belehrung zu retten – und dabei am eigenen Tonfall ersticken.
Er glaubt nicht an Verschwörungen. Aber er glaubt auch nicht an Zufälle in Regierungspapieren. Er glaubt an Strukturen, an Netzwerke, an Narrative – und an die stille Hoffnung, dass Schreiben manchmal mehr bewirken kann als jeder Parteitag.
Alfred-Walter von Staufen: geboren in der DDR, geformt vom Westen, geprägt von Schmerzen, angetrieben von Wahrheitssuche. Kein Prophet, kein Populist – aber jemand, der hinsieht, wenn andere schon müde weggucken.
Oder wie er selbst sagt:
„Ich habe lange genug in Rohren gearbeitet, um zu wissen: Am meisten Druck entsteht dort, wo das System verstopft ist.“