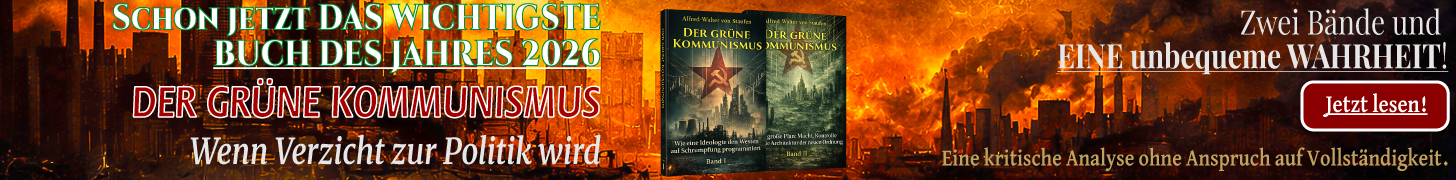Grüner Kommunismus-Traum: Wenn die Klimakrise zur Weltrevolution wird
Stellen Sie sich vor, Sie wachen auf in einer Welt, in der jedes Wetter eine Schlagzeile ist und jede Wolke eine Mahnung. Der Regen ist Protest, die Sonne Drohung, der Winter Beweis. Willkommen in der Ära der permanenten Apokalypse, die wir „Klimakrise“ nennen – ein Dauerbrenner der Angstökonomie.
Doch unter der glitzernden Oberfläche der Windräder, Wärmepumpen und Wasserstoffträume verbirgt sich etwas viel Größeres als CO₂-Moleküle: eine neue Gesellschaftsordnung. Die Dekarbonisierung – angeblich die technische Antwort auf die ökologische Frage – erweist sich immer mehr als politisches Werkzeug. Ihr Ziel ist nicht nur eine neue Energie, sondern ein neuer Mensch: gehorsam, überprüfbar, moralisch optimiert.
Wer heute von „Transformation“ spricht, meint selten Technologie. Gemeint ist ein Umbau der Lebensweise, gelenkt durch globale Gremien, supranationale Institutionen und moralische Priester in weißen Kitteln. Das Individuum schrumpft zum Emittenten, die Freiheit wird bilanziert, der Staat zur moralischen Buchhaltungsstelle.
Die eigentliche Pointe: All das passiert freiwillig – zumindest nennen sie es so. Niemand muss mitmachen. Aber wehe, du tust es nicht: Dann bist du der Klimasünder, der Ketzer, der CO₂-Prophet der alten Welt. Und so wächst, hinter grünen Parolen und veganen Kantinen, das älteste aller Systeme wieder heran: eine Weltgemeinschaft ohne Eigentum, ohne Wettbewerb, ohne Widerspruch – aber mit dem warmen Gefühl, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen.
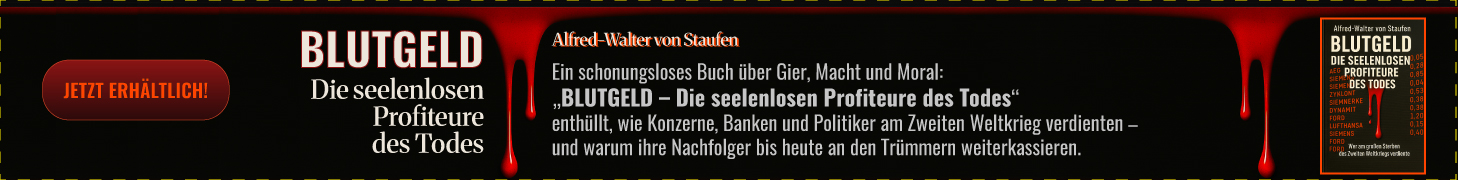
Man nannte das früher Kommunismus. Heute nennt man es Nachhaltigkeit.
Die weltweite kommunistische Transformation von Alfred-Walter von Staufen
Der Dauer-Notstand als Regierungsform
Der moderne Staat hat den heiligen Gral gefunden: einen Notstand ohne Ablaufdatum. Früher brauchte man Kriege, um Sondervollmachten zu rechtfertigen. Heute reicht ein ppm-Wert. „Die Klimakrise duldet keinen Aufschub“ – das ist nicht nur ein Satz, das ist eine Verfahrensanweisung: Debatten werden zu Dekor, Parlamente zu Theaterbühnen, auf denen der Plot bereits vorher feststeht. Man beschließt Ziele mit Jahreszahlen, so weit in der Zukunft, dass niemand, der sie ausruft, die Verantwortung für ihr Scheitern noch tragen muss. Praktisch. Und hübsch moralisch verpackt. Denn wer will schon gegen „die Zukunft der Kinder“ stimmen, außer der Grinch mit Diesel?
In diesem permanenten Alarmzustand verschmilzt Moral mit Macht. Aus „Wir müssen reden“ wird „Wir dürfen nicht länger reden“. Aus „Wir brauchen Ideen“ wird „Wir haben längst einen Plan“. Und aus Bürgern werden Adressaten von Verzichtsverordnungen. Jede Einwendung wird chirurgisch zerlegt: Ist sie fachlich, fehlt ihr Mitgefühl; ist sie sozial, fehlt ihr Sachverstand; ist sie wirtschaftlich, fehlt ihr Gewissen. So entsteht jene Einspurigkeit, die man früher Ein-Partei-Linie nannte und heute „Konsens der Wissenschaft“.
Der Clou: Der Notstand ist unsichtbar und universell. Er lässt sich überall ausrufen, unabhängig von Wetter, Wohlstand oder Wahltermin. Ein heißer Sommer hilft, ein kalter Winter auch: der eine „beweist Erwärmung“, der andere „beweist Kipppunkte im System“. Was er vor allem beweist: Die Lenkung funktioniert. In dieser Dramaturgie sind Windräder nicht nur Turbinen, sie sind Totems. Und wer am Totem rüttelt, rüttelt an der Legitimation des Notstands. Das Ergebnis ist ein neues Regieren: weniger über Gesetze, mehr über Leitbilder; weniger über Streit, mehr über Sündenregister. Willkommen in der Ära, in der sich Politik nicht begründen, sondern bekennen muss.
CO₂ als Weltwährung – das unsichtbare Geld der Tugend
Es war eine geniale Idee, wirklich: Man nehme ein farbloses Molekül, das jeder ausatmet, und erkläre es zur Preis- und Schuldmetrik der Zivilisation. Aus CO₂ wird „Carbon“, aus Carbon wird „Budget“, aus Budget wird Macht. Was früher Münze und Zentralbank war, wird heute Zertifikat und Obergrenze. Dekarbonisierung heißt dann nicht nur „weniger Emissionen“, es heißt Zuteilung: Wer darf wie viel leben, reisen, heizen, produzieren? Und vor allem: Wer vergibt die Erlaubnis?
Nicht zufällig erblühen überall CO₂-Börsen, ETS-Systeme, Scope-Kataloge. Ein globaler Ablasshandel – nur ohne Dom, dafür mit Dashboard. Unternehmen zählen nicht mehr Produkte, sie zählen Fußabdrücke. Der Konsument kauft nicht mehr eine Ware, sondern eine Erzählung: „klimaneutral“, „kompensiert“, „auf dem 1,5-Grad-Pfad“. Sogar die Schuld lässt sich outsourcen: Man pflanzt Bäume dort, wo man sonst nie hingefahren wäre, und fühlt sich sauberer als ein frisch gespültes Pfandglas.
Die neue Währung hat einen Vorteil: Sie ist elastisch. Man kann Budgets verknappen oder erweitern, je nach politischem Wetter. Man kann „Restbudgets“ beschwören, die nie jemand gesehen hat, und Sparbefehle daraus ableiten, die jeder spürt. Und man kann, das ist das Schönste, Gewissen in Gebühren umrechnen. Wer zahlen kann, darf sündigen: Flug frei, sobald das Häkchen bei „Kompensieren“ gesetzt ist. Für alle anderen gilt: Bodenhaftung – nicht als Tugend, sondern als Verordnung. So verwandelt sich CO₂ in eine sozioökonomische Schichtordnung. Wer viel emittieren darf, zeigt Status; wer wenig darf, zeigt Folgsamkeit. Und irgendwo zwischen den beiden sitzt die Politik und druckt Budgets wie einst Papiergeld – nur sauberer und unanfechtbarer.
Energie als Hebel der Lenkung
Fragen Sie jeden Systemtheoretiker: Wer die Energie kontrolliert, kontrolliert die Gesellschaft. Im fossilen Zeitalter war das zu offensichtlich, um politisch als moralische Mission durchzugehen. Im grünen Zeitalter ist es perfekt: Man muss nur behaupten, die Kraftquelle der Freiheit – billige, verlässliche Energie – sei der Feind des Planeten. Dann wird Knappheit zur Tugend und Zuteilung zur Fürsorge.
Die Dekarbonisierung verlegt die Massenproduktion von Energie in wetterabhängige, fluktuierende Formate. Das ist technisch machbar, aber sozial wirkmächtig: Wer auf Unregelmäßigkeit setzt, braucht Ausgleich – Akkus, Netze, Regeln. Mit jedem neuen Zubau wächst daher die Abhängigkeit von Koordination. Die Verteil-Algorithmen werden König, und mit ihnen jene, die sie schreiben. Es heißt: „Die Sonne schickt keine Rechnung.“ Schön. Dafür schickt sie Schatten – und die stellen Rechnung: für Speicher, für Netzausbau, für „Spitzenkappung“, für Smart-Meter-Disziplin.
Plötzlich ist der Bürger nicht mehr Kunde, sondern Knoten in einem System. Sein Verhalten ist Regelgröße: Ladezeiten, Spitzenlast, Einspeisegrenzen. Der eigene Zähler wird zum Resonanzkasten der Politik. Und weil Strom so höflich unsichtbar ist, lässt sich Verhalten elektrisch erziehen: Bonus hier, Malus dort, Abschaltbarkeit inklusive. Die alte Furcht vor dem großen Hebel im Kraftwerk wird ersetzt durch die neue Furcht vor dem kleinen Hebel im Keller.
So wird Dekarbonisierung zum Erziehungsprogramm. Nicht mehr „Du sollst nicht stehlen“, sondern „Du sollst nicht um 18:30 kochen“. Und wer widerspricht, dem erklärt man freundlich, er habe die Energiewende nicht verstanden. Doch die hat ihn sehr gut verstanden: als Stellgröße.
Die neue Bürokratie – ESG als Ersatzverfassung
Planwirtschaft war früher grau, groß und grob. Heute ist sie glänzend, granular und gedeckt durch ESG-Meme. Statt Fünfjahresplan gibt es Roadmaps, statt Kommissaren Taskforces, statt Kontingenten Taxonomien. Die Sprache ist softer, die Wirkung härter. Unternehmen führen Doppelfibeln: eine für Geld, eine für Tugendkennzahlen. Wer in der zweiten schlecht abschneidet, findet in der ersten bald keine Kredite mehr.
Das Besondere an ESG & Co.: Sie sind rechtsähnlich ohne zu wählen. Niemand hat die Aufsichtsgremien dieser Normen gewählt, und doch bestimmen sie, was „gute“ Investitionen sind. Politik outsourct das Streiten an Standardsetzer, die wiederum Indices liefern, an denen Fördergelder hängen. So entsteht eine Schattenverfassung mit
- Artikel 1: „Das Klima ist unantastbar.“
- Artikel 2: „Eigentum verpflichtet – erst recht zu Dekarbonisierung.“
- Artikel 3: „Abweichler bekommen keine Mittel.“
Bürokratie liebt Zahlen, die moralisch klingen. Darum die Zärtlichkeit, mit der man Scopes nummeriert und Materialitäten gewichtet. Wer widerspricht, ist nicht „anderer Meinung“, er ist „nicht regelkonform“. Und Regelkonforme sind die neue Aristokratie: Sie sprechen in Kennzahlen, sie reisen klimabewusst, sie trinken Bio-Wasser aus Stahlflaschen und nehmen den Business Seat der Wirklichkeit.
Die Krönung: Diese Bürokratie behauptet, Alternative zur Bürokratie zu sein. „Wir senken die regulatorische Last, indem wir Standardisierung erhöhen“ – das ist so schlagend wie „Wir senken den Blutdruck, indem wir die Manschette ständig angelegt lassen“. Ergebnis: Ein Betriebssystem aus Formularen, in dem Compliance nicht Rechtstreue bedeutet, sondern Weltrettungstreue.
Sozialtechnik: Tugend als Tarif
Der Markt verteilt nach Preis, der Staat nach Gesetz, die neue Ordnung nach Tugendtarif. Wer „richtig“ lebt, erhält Boni: ein 49-Euro-Ticket in grünem Lack, Förderungen für Wärmepumpen, Einbau-Ritterschlag im Mietshaus. Wer „falsch“ lebt – Haus im Dorf, altes Auto, Gastherme – zahlt Moralaufschlag. Natürlich heißt das nicht Strafe; das heißt „Lenkungswirkung“.
Die Konditionierung folgt bekannten Mustern: Punktesysteme, freiwillig-verbindlich. Erst sind es „Nudges“, dann „Standards“, schließlich „Pflichten“. Und wenn jemand fragt, ob das nicht etwas kontrollfreudig sei, lächelt die Politik: „Aber es ist doch fürs Klima!“ In dieser Formel steckt der Trick: Mit dem Höchsten Gut lässt sich jeder Eingriff rechtfertigen – vom Parkverbot bis zur Heizungsnovelle.
Das erzeugt neue Klassen. Nicht mehr Arbeiter gegen Kapital, sondern Thermoneutral gegen Thermosünder. Die Erzählung vom „gerechten Übergang“ dient als weiches Kissen über harten Verteilungskämpfen. Und weil die Kosten zeitlich versetzt kommen – Investition heute, versprochene Einsparung morgen – lässt sich nahezu jede Härte pädagogisch verpacken. Der Pädagoge heißt „Transformationsfonds“; sein Lineal ist der CO₂-Preis.
Die Komik (von der bitteren Sorte): Ausgerechnet jene, die früher „Mein Körper, meine Entscheidung“ riefen, legen jetzt Nutzungsregime für alle Lebensvorgänge vor – vom Duschrhythmus bis zur Kilometerbilanz. Und wenn jemand trotzig wird, erinnert man ihn ans große Ganze. Mehr Demut wagen, weniger Freiheit brauchen: Das ist der neue Tugendtarif.
Digital-Klima: Zähler, Zügel, Zuteilung
Die digitale Infrastruktur ist das Zugseil der Dekarbonisierung. Ohne Smart-Meter, Lastmanagement, KI-Prognose bleibt die Energiewende Romantik. Mit ihnen wird sie Regime. Denn Digitalisierung bedeutet nicht nur Effizienz, sie bedeutet Messbarkeit – und Messbarkeit bedeutet Interventionsrecht. Wer den Datenfluss beherrscht, kann Verhalten schalten.
Das beginnt harmlos: „Wir zeigen Ihnen in der App, wann Strom grün ist.“ Es endet da, wo Apps zu Gatekeepern werden: Ticket nur freigeschaltet, wenn Budget da; Ladevorgang nur mit Netzfreigabe; Heizung gedimmt bei Netzstress. Alles gut begründet, alles technisch sauber – und politisch mächtig. Aus Freiheit wird good practice, aus Recht wird Use Case.
Dazu gesellt sich die Digital-Klausel des 21. Jahrhunderts: „Wer etwas zu verbergen hat, hat etwas falsch gemacht.“ Also misst man alles – und ruft es „Transparenz“ statt Kontrolle. Unternehmen liefern Echtzeit-Berichte, Haushalte Lastprofile, Kommunen Mobilitätsheatmaps. Irgendwann weiß das System, wer du bist, wenn du das Licht anmachst.
In diesem Raster kann man „gute Bürger“ belohnen. Und belohnen ist eleganter als bestrafen: Rabatte sind Sympathiegesetze. Aber ökonomisch sind sie dasselbe wie Strafen für alle, die sie nicht bekommen. So schleicht die digitale Mangelverwaltung in die Normalität. Ein bisschen „Peak-Shaving“ hier, ein bisschen „Demand-Response“ da – und schon ist der Eindruck der Freiheit gewahrt, während die Funktion der Freiheit ausgelagert wurde: an Serverräume mit Zertifikaten.
Die Pointe: Technik ist nicht neutral, sobald sie politische Ziele trägt. Ein smarter Zähler ist ein disziplinierter Bürger im Gehäuse. Und wer das Gehäuse baut, baut die Gesellschaft um.
Geopolitik der Tugend – und der Lieferketten
Eine Welt, die Dekarbonisierung verordnet, muss Material holen. Viel Material. Metalle, seltene Erden, Kupfer, Silizium, Rohstoffe aus Regionen, die politisch weniger seminarfähig sind als westliche Ausschüsse. Damit wird die Moralökonomie zur Abhängigkeitsökonomie. Man schaltet das eigene Kraftwerk ab und schaltet dafür Minenschächte anderswo an – samt den sozialen und ökologischen Kosten, die man zu Hause nicht sehen will.
Die Lieferketten erzählen nicht von Erlösung, sondern von Konzentration: Wer Rohstoffe kontrolliert, diktiert Tempo und Preis der Tugend. Ausgerechnet jene, die vom „Ende der fossilen Geopolitik“ schwärmen, bauen eine neue Geopolitik – nur mit anderen Ventilen. Der Hebel ist nicht mehr Pipeline, der Hebel heißt Nadelöhr: Hafen, Halbleiter, Zellchemie.
Gleichzeitig wächst die Strategie-Heuchelei. Man erklärt sich unabhängig vom Öl – und wird abhängig von Inselketten der Technologie. Man predigt „Resilienz“ – und schafft Single Points of Failure in globalen Fabriken, die gegen jede Störung so robust sind wie ein Kerzenständer im Sturm.
Die politische Folge: Konzessionen. Wer die Komponenten liefert, liefert bald auch die Narrative. Dann wird die Dekarbonisierung nicht mehr nur eine Umweltgeschichte, sondern eine Machtgeschichte – und zwar die alte, in der Abhängige brav die Lieder der Versorger singen. Die Utopie vom kooperativen Weltklimaprojekt landet auf dem Basar: Zölle gegen Zertifikate, Standards gegen Zugang. Am Ende schützt nicht die Atmosphäre die Freiheit, sondern Eigenständigkeit – und genau die baut man ab, im Namen der guten Sache.
Ökonomie der Kappung – wenn Effizienz Enge wird
Die politische Lyrik sagt: „Grüne Transformation schafft Wohlstand.“ Die Betriebswirtschaft antwortet: „Wovon?“ Schließlich bezahlt jemand die Kapitalbindung in Netzen, Speichern, Redundanzen. Die Kosten mögen über Abgaben und Schattenpreise streuen, sie verschwinden nicht. Dekarbonisierung erzeugt Fixkosten mit Moralpflicht. Die rechnen anders: nicht nach Preis/Leistung, sondern nach Ziel/Erzählung.
Die Folge ist eine Ökonomie der Kappung: Spitzen werden „gemanagt“, Nachfrage „verschoben“, Produktion „flexibilisiert“. Hinter diesen Euphemismen steht eine verordnete Ineffizienz. Systeme, die früher auf Zuverlässigkeit optimiert waren, werden auf Möglichkeit getrimmt. Das geht – nur kostet es Optionen: Produktionsfenster, Servicezeiten, Lebensqualität.
Viele merken es spät, weil Förderkulissen das Bild weichzeichnen. Doch Subventionen sind keine Energiequelle; sie sind Umlenkungen. Wer die Prise Wirtschaft – Wettbewerb, Innovation, Kostendruck – an die Leine nimmt, hält bald nur noch das Halsband in der Hand. Und wenn dann der Export schwächelt und der Standort stöhnt, lautet der Reflex: Noch mehr Lenkung.
Hier beginnt der kommunistische Reflex im grünen Gewand: Die Planabweichung ist nicht Anlass zum Umdenken, sondern Beweis für mangelnde Planerfüllung. Lösung: mehr Plan. So dreht sich die Spirale aus Vorschriften, Ausnahmen, Nachbesserungen. In politischen Meme heißt das „Kohärenz erhöhen“. Auf Lohnzetteln heißt das „Reallohn senken“.
Die bittere Wahrheit: Wohlstand ist nicht die Summe guter Absichten, sondern die Summe günstiger, verlässlicher Energie plus Freiheit. Wer beides verknappt, verknappt am Ende Zukunft – nicht abstrakt, sondern auf dem Kontoauszug.
Klima als Zivilreligion – Sakramente der Erlösung
Jede Ordnung braucht Rituale. Die neue Ordnung hat viele: Fridays, Earth Hours, Veganuarys, Klimastadträume. Sie schafft Sakramente, die den Einzelnen ans Ganze ketten: Verzichtsgelübde, Bekenntnisse, Pilgerfahrten zum Recyclinghof. Der Kitt ist Scham – die sozial akzeptierte Form von Angst. „Flugscham“, „Heizscham“, „Grillscham“.
Glauben Sie nicht? Prüfen Sie die Ikonographie: schmelzende Gletscher als Memento mori, brennende Wälder als Höllenvision, das 1,5-Grad-Zahlwort als Dogma. Ketzer sind Leugner, Häretiker heißen Relativierer, und wer Abbitte leistet, darf „zurück in den Diskurs“. Das ist kein naturwissenschaftlicher Diskurs mehr; das ist liturgische Kommunikation.
Religio heißt Rückbindung – an Gott, an Sinn, an Ordnung. Die Rückbindung der Klima-Zivilreligion ist an Autoritäten, die man „die Wissenschaft“ nennt, als wäre sie ein Konzil. Skepsis, die früher Motor der Wissenschaft war, gilt nun als Fehler im Betriebssystem. Wer fragt, ob Modelle unsicher sind, hat „die Lage nicht verstanden“. Wer fragt, ob Politik demokratisch sein muss, hat „die Dramatik nicht begriffen“.
Aber: Ohne Zweifel keine Mündigkeit. Ohne Streit keine Republik. Die Zivilreligion ersetzt Zweifel durch Zelebrieren. Das erzeugt Geschlossenheit, ja – und Blindheit. Und Blindheit ist die perfekte Voraussetzung für Anmaßung. So öffnet die Klimareligion die Tür, durch die die grüne Planwirtschaft schreitet – höflich lächelnd, straff organisiert, in Bestform für die Ewigkeit.
Ein anderer Weg: Öko ohne Zwang, Klima ohne Kader
Die Alternative ist nicht Zynismus, sondern Erwachsenwerden. Dekarbonisierung kann Sinn ergeben – regional, technologisch, marktbasiert, inkrementell. Aber sie darf nicht als Vorwand dienen, die Gesellschaft in Kommandokaskaden zu zwingen. Wir brauchen Preissignale statt Pönalen, Innovation statt Ideologie, Wettbewerb statt Weltplan.
Konkret heißt das: Technologieoffenheit ernst meinen; Sektorziele durch Ergebnisziele ersetzen; Eigentumsrechte schützen, statt sie via Auflagen zu verdünnen; Strompreise entpolitisieren, Netze ausbauen, Markteinstiege erleichtern. Vor allem aber: Subventionen befristen und an messbaren Ertrag knüpfen, nicht an moralische Schlagworte.
Transparenz ist kein Stimmungsbild, sie ist Rechnung. Rechnen wir ehrlich: Was kosten Maßnahmen voll, nicht im Schaufenster? Welche Opportunitäten opfern wir? Wie hoch ist die politische Rendite (Machtgewinn), wie hoch die soziale Rendite (Wohlstand, Freiheit)?
Und: Demokratie zuerst. Keine Zielvorgabe ohne parlamentarische Kontrolle, keine exekutive Selbstermächtigung unter dem Deckmantel „Alternativlos“. Keine Dämonisierung von Kritik. Wer Freiheit ernst meint, muss Ambivalenz aushalten. Ja, die Welt könnte wärmer werden. Und ja, die Welt wird ganz sicher autoritärer, wenn wir das Klima zur Generalvollmacht erklären.
Kurz: Öko-Liberalismus statt Klima-Leninismus. Oder, im Bild: Wir brauchen Gärtner, keine Kommissare. Gärtner können schneiden, pflegen, düngen – aber sie befehlen der Natur nicht. Wer Politik so denkt, kann Klimaschutz und Freiheit versöhnen. Wer es nicht tut, rettet vielleicht die Atmosphäre, aber erstickt die Republik.
Abschluss & Moral
Was bleibt, wenn man das ganze grüne Rauschen abdreht?
Ein nüchterner Gedanke: Jede Generation braucht ihr moralisches Kostüm. Früher war’s Religion, dann Ideologie, heute ist es Klima. Die Priester heißen jetzt Wissenschaftler, die Beichten nennt man CO₂-Bilanzen, und die Ablassbriefe kommen als Förderbescheide.
Doch der Zweck heiligt auch diesmal die Mittel – und die Mittel heißen Kontrolle. Wer Energie rationiert, rationiert Freiheit. Wer Verzicht institutionalisiert, institutionalisiert Gehorsam. Und wer eine Gesellschaft in „gute“ und „schlechte“ Emittenten einteilt, führt die alte Klassenlogik nur mit smarteren Tools fort.
Die Moral? Ganz einfach:
Die Welt wird nicht besser, wenn sie weniger CO₂ hat, aber mehr Zwang. Sie wird nicht gerechter, wenn sie klimaneutral, aber demokratiearm ist. Und sie wird nicht freier, wenn sie jedes Handeln unter die Lupe der Moral stellt.
Der Weg in die grüne Zukunft ist kein ökologischer – es ist ein ideologischer. Und am Ende steht nicht das Paradies der Nachhaltigkeit, sondern der digital-ökologische Kommunismus: eine Planwirtschaft mit WLAN, eine Welt ohne Eigentum, aber mit Öko-Score.
Oder wie Harald Schmidt es formulieren würde:
„Wenn du dein E-Auto nicht laden darfst, weil das Netz überlastet ist, sei stolz – du bist Teil der Lösung.“
Ironischerweise stimmt das. Nur weiß niemand mehr, welches Problem wir damit eigentlich lösen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieses Essay war keine Einladung zum Fatalismus, sondern zum Denken. Ich möchte, dass Sie den Unterschied erkennen zwischen Klimaschutz und Klimapolitik, zwischen Ökologie und Öko-Ideologie. Es geht nicht darum, das Klima zu leugnen, sondern die Freiheit zu retten.
Freiheit atmet – CO₂ inbegriffen.
Wenn wir zulassen, dass Angst unser Steuermodell wird, werden wir nicht nachhaltiger, sondern steuerbarer.
Bleiben Sie wach, zweifelnd, unbequem. Fragen Sie nach – nicht weil Sie gegen das Klima sind, sondern weil Sie für den Menschen sind.
Denn ohne kritischen Geist bleibt nur warme Luft.
Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!
Herzlichst
Ihr Alfred-Walter von Staufen
Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!
In eigener Sache:
Ich bin in meinem ersten Buch: „Der geheime Pakt der Freimaurer, Khasaren und Jesuiten: Wir bleiben durch unser Blut verbunden. Tod dem, der darüber spricht!“ der Frage nachgegangen: Was ist eigentlich Demokratie. Überlegen Sie doch bitte einmal selber: Wenn nach einer Wahl die großen Volksparteien entscheiden, wer in den Parteien das Sagen hat, um dann zu entscheiden, wer das Sagen im ganzen Land hat, ohne dass die Menschen im Land etwas dazu zu sagen haben, nennt man dies noch Demokratie?!
Ich suchte auch Antworten, wer die Wächter des Goldes sind und was der Schwur der Jesuiten besagt? Sind die „Protokolle der Weisen von Zion“ wirklich nur eine Fälschung? Was steht in der Balfour-Erklärung geschrieben? Ist die „Rose“ wirklich die Blume der Liebe oder steht sie viel mehr für eine Sklavengesellschaft? Was ist eigentlich aus dem Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach und dem Sachsensumpf geworden? Sind die Heiligen, welche wir anbeten, wirklich unsere Heiligen oder Götzenbilder des Teufels? Was hat es in Wahrheit mit dem Bio-Siegel auf sich?
Im vorletzten Kapitel dieses Buches dreht es sich um die augenscheinlichen Lügen und das Zusammenspiel der Politik, Banken und Wissenschaft.
Eine sehr wichtige Botschaft möchte ich am Ende des Buches in die Welt senden: Wir dürfen uns nicht mehr spalten lassen, denn der kleinste gemeinsame Nenner, zwischen uns allen dürfte sein, dass wir inzwischen ALLE extrem die Schnauze von diesem System voll haben und darauf sollten wir aufbauen!
Unser Buch: „Die Autorität: Die geheime Macht der Blutlinien der Pharaonen“
SIE WAREN NIE WIRKLICH WEG, JETZT HERRSCHT DIE AUTORITÄT ÜBER DIE GANZE MENSCHHEIT
Wir vermitteln Ihnen Informationen, welches Ihr falsch erlerntes Weltbild zerstören werden. Ein Weltbild, welches Ihnen seit Ihrer Geburt aufgezwungen wurde und dem man nicht entkommen kann bis zu diesem Buch. Das, was Ihnen überall durch die Medien erzählt wird, hat nicht viel mit der Realität zu tun. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr die Realität sogar das genaue Gegenteil von dem ist, was Sie ständig hören und sehen. Das ist nicht nur die satanische Verdrehung der Wahrheit, sondern auch die Umkehrung der Geschichte. Denn nicht einmal auf die Jahreszahlen können Sie sich verlassen. Ihre Organisationen verwenden zahlreiche Methoden, um die Manipulation der Menschheit still und heimlich zu implementieren. Sie benutzen die Medien und Prominente, damit ihre weitreichenden Pläne eine akzeptable Basis bei der Mehrzahl der Menschen finden. Sie sind nur ein Zahnrad in einem riesigen Getriebe, welches die Welt so wie sie ist, am Laufen hält. Weisheit und Macht sind nur auserwählten Familien oder Politikern, die uneingeschränkt dienen, zugänglich. Darum sind wir alle, in den Augen der herrschenden Elite, nichts anderes als Sklaven und zwar Freiwillige, eine Nummer, einer von Milliarden oder auch gerne als Schafe, Vieh oder Ratten bezeichnet. Wir sind ihr ausführendes Personal in einem betrügerischen Schuldgeldsystem, dem wohl wissend und stillschweigend alle zustimmen. Dieses System existiert seit den Zeiten der Pharaonen. Deren Machtstrukturen und Symbolik aus dem alten Ägypten finden Sie in den Logen, Religionen, Unternehmen und globalen Organisationen bis hin zum scheinbar vergnüglichen Kult des Karnevals. Nichts ist wie es scheint. Politiker und andere Berühmtheiten aus Fernsehen und Sport mit Dreck am Stecken gehören entweder zum Establishment oder dienen einem bestimmten Zweck und werden deshalb geschützt. Missbrauch, Pädophilie und Einschüchterung bis hin zum rituellen Mord gehören zum Repertoire der Verschwörer in den Logen. Die Blutlinien der Nachfahren der Pharaonen haben ihre Macht wie ein Spinnennetz über die Erde gelegt und wirken bis in die kleinsten Nischen unseres Alltags. Doch heute sind es nicht die Pharaonen welche das Schicksal der Erde denken und lenken, heute hat die Autorität die Könige, Präsidenten, Päpste, Milliardäre sowie unzählige Handlanger wie Schauspieler, Sänger und andere Prominente installiert. Sie gehören zum immerwährenden Programm wie Teile und Herrsche, Brot und Spiele oder die Ruhigstellung durch Wahlen von Politikern, die Veränderungen bringen sollen aber doch nur alle der Autorität dienen. Das Warte-Spiel der falschen Propheten, nutzt ebenso nur den böswilligen Kräften der Autorität und deren Kontrolle über uns. Vertrauen Sie also nicht dem scheinheiligen und göttlichen Plan und stopfen Sie sich nicht jeden Abend Popcorn in den Kopf. Ehren Sie stattdessen Ihren Weg, fassen Sie Mut und Verantwortung für Ihr Sein.
Dieses Buch ist Ihr Wegweiser!
Abbildungen:
- Alfred-Walter von Staufen
Quellenverzeichnis:
- Brand, Ulrich et al.: Structural Limitations of the Decarbonization State, Nature Climate Change (2025).
- Frisch, T.: A Slow and Deceitful Path to Decarbonization?, Elsevier (2024).
- Nyberg, D.: Confronting the Climate Crisis: Fossil Fuel Hegemony and Organizational Change, Journal of Management Studies (2024).
- Copley, J.: Decarbonizing the Downturn, Sage Journals (2023).
- Henze, L. T.: The Implications of Technical Change for Climate Policy, Dezernat Zukunft (2023).
- UNFCCC: Decarbonization is the Biggest Transformation of the Global Economy of this Century, 2024.
- Wikipedia (en): Capitalocene – Concept and Criticism.
- Time Magazine (2018): Yellow Vests and Climate Policy Backlash.
- OECD Report (2023): Energy Transitions and Economic Resilience.
- IPCC AR6 Summary (2023) – Global Governance for Net Zero Goals.